Als das Fernsehen aufkam, hat sein Publikum damit einen immer grösseren Teil seiner Freizeit verbracht. Der Bildschirm öffnete in der Wohnung ein Fenster zur weiten Welt. Mit den Rechnern wurden Bildschirme an den Arbeitsplätzen aufgestellt, zunächst nur zu eng definierten Zwecken, dann multifunktional und vernetzt, und schnell sind die Computer auch ins Privatleben eingezogen. Viele Menschen leben inzwischen täglich stundenlang vor den Schirmen. Es ist angeraten, zu erkennen, was das bedeutet.
Wie verhalten sich Menschen am Rechner, dem Bildschirm gegenüber? Da die Geräte anders als das Fernsehen interaktiv sind, gibt es etwas zu tun. Deshalb wird hier zuerst das physische Verhalten beobachtet - nicht ein extremes, sondern der durchschnittliche Normalfall.
Arbeit mit den Fingerspitzen gibt es schon bei der Schreibmaschine, jetzt ist sie das Übliche: An verschiedenen Geräten werden Eingaben über Tastatur, Maus, Berührbildschirm oder Schalter erwartet, an Rechnern, Telefonen, Automaten für Geld oder Fahrkarten, Kassen, Steuer- und Registriergeräten - ausser wenn Daten mit einem Lesegerät erfasst werden. Die Finger werden beim Tippen und Klicken meistens gleichförmig von oben nach unten bewegt. Die Hände bewegen sich dabei und bei der Mausführung schematisch und auf engem Raum. Andere Fähigkeiten der Hände wie das Greifen - von dem sich das Begreifen ableitet - werden ausser bei der immer gleichen Maus nicht angewendet. Zielsicherheit und Ausdauer sind nötig, aber nicht Fingerspitzengefühl - das wird taub.
Das Wort “digital” kommt vom Zählen mit den Fingern; zum Rechnen werden die Hände so nicht mehr gebraucht, und auch vieles andere müssen sie nicht mehr können.
Zwischen der Eingabe und dem Ergebnis auf dem Schirm ist ein sinnlich nicht nachvollziehbarer Abstand. Das Ergebnis ist von verschiedenen Einstellungen (Formatierung etc.) abhängig und über das digitale Programm vermittelt, aber es hat nicht spürbar mit der normierten Hand- und Fingerbewegung zu tun.
Dem Bildschirm gegenüber ist der Blick auf ein Rechteck fixiert, oft im gleichbleibenden Abstand und stundenlang. Bei mobilen Kommunikationsgeräten ist das Sichtfeld klein. Die Darstellung ist zweidimensional. Anders als in der komplexen räumlichen Wirklichkeit ist die Sehtätigkeit sehr beschränkt und spezialisiert. Ton zum Hören ist dabei, andere sinnliche Fähigkeiten (Fühlen, Riechen, Schmecken…) werden nicht beansprucht.
Das Radio lässt dagegen viel mehr Freiheit für die Fantasie…
Die Körperhaltung vor dem Bildschirm ist insgesamt fast stillgestellt, der Mensch sitzt fest. Mit einem Buch oder einer Zeitung ist es anders: Lesen ist in verschiedenen Haltungen möglich, die Hände greifen und fühlen den Gegenstand, blättern um…
Bei interaktiven Geräten, besonders da, wo Automaten persönliche Beziehungen ersetzen, werden zudem die Besonderheiten und vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Kommunikation nicht mehr gebraucht, der Ton der Sprache, der gegenseitige Blickkontakt, Mimik und Gestik. Die Tendenz ist, dass sie nicht ausreichend geübt werden, oder sie werden sogar verlernt.
Die digitale Technologie standardisiert menschliche Handlungs- und Denkweisen. Die meisten üblichen Anwendungsprogramme sind inzwischen gleich aufgebaut und verlangen die gleichen Vollzüge: Datei öffnen - bearbeiten - Schreibmarke setzen - markieren - kopieren und einfügen - Datei speichern; es wird immer wieder aus “Menüs” ausgewählt und mit “Eingabe” ein Beschluss ausgeführt; es wird heruntergeladen statt im Laden erworben. Zum Vergleich: Diese Arbeitschritte gelten auch für die digitale Bildbearbeitung, während sich in einem analogen Fotolabor ganz eigene Materialien, Handgriffe und Abläufe fanden. Das vereinheitlichte Handeln wirkt sich auf das Denken aus. Ausdrücke für häufige Vorgänge am Rechner wie “Multitasking” für den schnellen Wechsel zwischen Programmen und Bildschirmfenstern wurden auf die menschliche Bewältigung von Alltagssituationen übertragen - das macht den Einfluss deutlich.
Das Wissen der Menschheit liegt im Netz; zumindest das, was als relevant gilt, und dazu viel, was eher als kollektives Unbewusstes anzusehen ist und oft chaotisch anmutet. Alles, oder jedenfalls das, was üblicherweise gebraucht wird, ist im Internet abrufbar. Damit eröffnen sich einerseits ungeahnte Möglichkeiten. Andererseits: Wir müssen sowieso zu viel wissen - jetzt müssen wir uns nichts mehr merken. Über die Schnittstelle zwischen Mensch und Suchmaschine beziehen wir nach Bedarf Informationen, die wir meistens schnell wieder vergessen können, weil sie nur kurze Zeit aktuell sind. Das individuelle Gedächtnis schrumpft. Darin bleiben vielleicht noch persönliche Erinnerungen, an Erlebnisse, Begegnungen, Erfolge, Kränkungen, Genüsse. Früher wurde viel auswendig gelernt und war jederzeit präsent, Menschen konnten Geschichten erzählen, die sie nicht selbst erlebt, aber nachvollzogen hatten, sie sagten Gedichte auf, hatten historische Daten parat. Heute gibt es noch die erlebten Geschichten, aber wer kann auch nur einigermassen überzeugend die Geschichte eines gerade gesehenen Films wiedergeben?
Wenn das Gedächtnis fehlt, ist das Denken behindert. Denn das Denken braucht als Grundlage Wissensdaten, die es verbinden oder unterscheiden kann. Die müssen unmittelbar vorhanden sein - wenn sie erst technisch besorgt werden müssen, ist der Gedankengang unterbrochen. Überhaupt ist das Denken orientierungsgestört, wenn sich im Gedächtnis nicht schon Fakten und Beurteilungen zu einer Struktur angeordnet haben. Stattdessen spontanen Informationsimpulsen zu folgen, kann interessant sein und auch zu einer assoziativen Struktur führen, aber die wird ziemlich zufällig und beliebig. Übersicht und Durchblick werden so nur ausnahmsweise zustande kommen.
Die Beziehungen zwischen Menschen verändern sich. Im Netz pulsiert die Kommunikation. Weltweit gibt es schnelle Kontakte, Botschaften erreichen sofort ein globales Publikum. Allerdings sehen sich die Beteiligten meistens nicht, sie erleben nicht eine räumliche Begegnungssituation mit ihrer natürlichen und wichtigen Komplexität. Die grosse Masse der Aussagen in Foren und Blogkommentaren ist zudem banal, oberflächlich, nichtssagend. Die “Gemeinschaften”, die entstehen, sind vielfach fiktiv. Das Gefühl, dazuzugehören, ist dann kaum tiefgehend.
Das Vorgegebene im Netz, Texte, Bilder, Musik, ersetzt ausserdem sozialen Austausch im wirklichen Leben. Wir müssen niemanden fragen, mit niemandem diskutieren, mit niemandem etwas ausmachen. Vor dem Bildschirm sind wir allein - vor dem des Rechners noch mehr als vor dem (bisher noch getrennten) des Fernsehgeräts, das mit seinem festen Sendeprogramm oder einem vorrätigen DVD-Film noch gemeinsames Schauen veranlassen kann. Die menschliche Isolierung an den Bildschirmen reduziert am Arbeitsplatz und in der Freizeit sowohl soziale und kommunikative Fähigkeiten als auch die daraus sonst entstehenden Gewinne an Erfahrung, Selbstbewusstsein, Bildung und Gemeinschaftserleben.
Die Rechner und ihre Infrastruktur sind selbstverständlich Mittel für die Rationalisierung der Arbeit. Maschinen haben zunächst körperlich anstrengende und dreckige menschliche Arbeit übernommen. Dann sind durch die Rechner Arbeitskräfte in den Büros überflüssig geworden. Der Kampf um die Arbeitsplätze - den es bei entsprechend kürzerer Arbeitszeit für alle gar nicht geben müsste! - bringt Unsicherheit, Druck, Ängste, noch intensivere Vereinzelung mit sich, die weiteren Folgen sind Zwänge zu übermässiger Flexibilität und Mobilität. Dass es heute bei beruflicher Tätigkeit in der Ferne leichter ist, mit der Familie, den Freunden und Kolleginnen in der Heimat zu kommunizieren, ist nur ein schwacher Ausgleich. Wer keine Arbeit mehr hat, kann sich verstärkt dem Rechner daheim widmen.
Hier soll nicht die Rede sein von Internetsucht, Kriminalität im Netz, Datenmissbrauch, weil dafür die Technologie nicht Ursache ist und etwas dagegen getan werden kann, privat, rechtlich oder politisch.
Aber wie sollen wir mit dem alltäglich gewordenen Netz umgehen? Kaum jemand wird sich problemlos anpassen, und das sollten wir auch nicht. Angebracht ist eine gewisse Distanz, räumlich und kritisch: immer wieder rechtzeitig vom Schirm wegsehen, weggehen, eine Pause machen. Auch mal mit Stift und Papier schreiben, ein Buch lesen. Sich selbst fühlen und es spüren, wenn eine andere Beschäftigung wohler täte. Mit anderen Menschen zusammen sein. Es gibt ein Leben ausserhalb des Netzes…
maximil
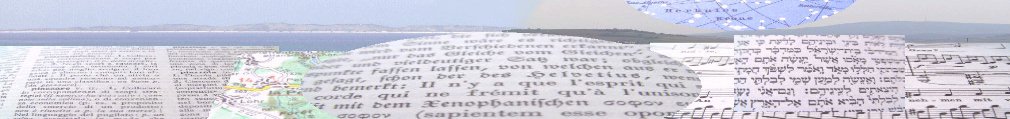
0 Kommentare bis jetzt ↓
Dieser wäre der erste.
Kommentar