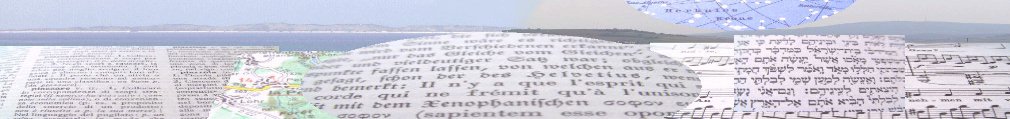17. Juli 2010
Ich habe von einem Einsiedler gehört, ich weiss nicht, ob er vor langer Zeit gelebt hat oder ob er noch lebt. Der Einsiedler siedelte also einzeln, allein, das heisst er wohnte irgendwo möglichst weit weg von anderen Menschen, in einer einsamen Gegend, wo gibt es so eine heute noch? Wahrscheinlich liebte er die Natur. Er lebte da, um das Leben zu spüren - vermute ich.
Es gibt aber auch Einsiedler und Einsiedlerinnen, die Wand an Wand mit anderen Menschen wohnen, zu denen sie keine Beziehungen haben. Manche Einzelkinder leben schon so, allein vor einem Bildschirm, der ein Tor ist, das weit offen vor einer geheimnisvollen Welt zu sein scheint, aber das täuscht leider. Aus Sicherheitsgründen werden Zugänge gesperrt, und es nützt dir nichts, wenn du sie umgehst, du verirrst dich und es drohen Fallen.
Früher waren Einsiedler oft religiös. Sie wollten wissen oder fühlen, was wichtig ist: Kosmos, Gott, das Leben. Darüber lässt sich aber schwer etwas Eindeutiges sagen.
Der Einsiedler, von dem ich erzählen will, hatte sich vorgenommen, jeden Tag etwas aufzuschreiben, was ihm gefallen hat. Wenn ihm das Essen geschmeckt hat, schrieb er darüber am Abend in ein Buch mit anfangs leeren Seiten, und er versuchte auch, den Geschmack und seine Empfindungen zu beschreiben. Wenn er etwas Neues gelernt oder erfahren hat, schrieb er es auf. Oder er hat an einem langen Sommerabend geglaubt, dass die Zeit still steht und es gut ist so - dann hat er das in Worte gefasst und mit Tintenstift aufs Papier gebracht. Er wollte das Wohltuende dokumentieren und damit festhalten, denn er dachte, er würde es einmal wieder brauchen können, oder jemand sonst. Er fühlte sich wohl dabei.
An einem Abend wollte er gerade eine Musik beschreiben, die ihn begeistert hatte, da ging ihm die Tinte aus. Er hatte keine andere Mine mehr im Haus, auch keinen anderen Stift und keine Tastatur. Der nächste Schreibwarenladen war Kilometer weit entfernt und ausserdem schon zu. Nachbarn gab es nicht. Der Einsiedler war beunruhigt.
Würde sein Musikerlebnis nun sang- und klanglos verschwinden? War diese Blockade nicht sogar ärgerlich? Vielleicht sollte er das, was er schreiben wollte, wenigstens aussprechen - so würde der Schall seiner Worte in die Atmosphäre, die Natur, die Welt hinein wirken. Das wäre allerdings kaum nachvollziehbar, überlegte er kritisch, aber womöglich direkter und dynamischer als ruhende Schriftzeichen. Und es entsprach den Klängen, die der Anlass seines Formulierens gewesen waren.
So sprach er sein Lob der Musik durch ein geöffnetes Fenster in die nur von einem leichten Wind bewegte Abendluft, deutlich, etwas ins Singen kommend, und schliesslich schien der Horizont der Hügel leise zu schwingen.
Als der Einsiedler sich schlafen legte, spürte er Zweifel. Das Gesprochene akustisch aufzeichnen, das wäre schon sicherer. Er hatte dafür kein Gerät, nicht einmal ein Telefon, mit dem er seinen Text auf einen Anrufbeantworter hätte sprechen können.
Am nächsten Tag verliess der Einsiedler sein Haus in den Hügeln und ging auf eine Reise, um eine alte Freundin zu besuchen und ihr zu sagen, was ihm wichtig war.
Jedenfalls habe ich die Geschichte so verstanden.
Claire Destinée

Themen: Allgemein · Kultur · Natur
8. Juni 2010
Anders als Fernsehen oder Internet kann Theater ein Thema, eine Angelegenheit, eine Geschichte in nächster Nähe darstellen. Die Zuschauenden können sogar zu Mithandelnden werden. Theater führt Möglichkeiten vor. Damit löst es bei seinem Publikum Gedanken und Emotionen aus, die sich auf das reale Leben danach auswirken. Eine politische Theatertruppe wie die “Berliner Compagnie” lässt auf einen Auftritt Diskussionen folgen, und gelegentlich schliesst sich eine gemeinsame Aktion an.
Die “Berliner Compagnie” macht seit 1981 Theater für Menschenrechte, Frieden und Entwicklung. Sie beruft sich auf das epische Theater von Bertolt Brecht, das Dokumentartheater von Peter Weiss, das Théâtre du Soleil von Ariane Mnouchkine. Mehrere Stücke hat sie im Programm, die interessierte Veranstalter, auch Schulen, Verbände und Initiativen, im deutschsprachigen Raum für Gastspiele buchen können:
- In “Das Blaue Wunder” geht es ums Wasser, eine Ressource, die weltweit knapp wird. Mithilfe der Politik ist sie inzwischen ein lukratives Geschäft für Konzerne. Menschen, für die sie ein Lebensmittel ist, über das sie frei verfügen wollen, treten dem entgegen.
- “Die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch” zeigt den Afghanistan-Krieg aus der Sicht einer einheimischen Familie. Deutlich wird, dass es Alternativen zur Gewalt gibt.
- “Die Weissen kommen” - nach Afrika, auch heute noch mit der Absicht, diesen Erdteil auszubeuten. Die Menschen dort mit ihren Vorstellungen vom Leben erscheinen auf der Bühne, um wahrgenommen zu werden.
Weiter bietet die “Berliner Compagnie” Aufführungen, die sich mit der globalen Landwirtschaft befassen, mit ethisch sauberer Kleidung und sozialen Bewegungen.
Berliner Compagnie
maximil
Themen: Allgemein · Kultur · Politik
16. März 2010
Die “Aktion Lebendiges Deutsch” sammelt und bewertet deutsche Entsprechungen für Ausdrücke, die aus dem Englischen kommen. Der
dahinter stehende Verein Deutsche Sprache begründet es so: “Wir bejahen die Bereicherung des Deutschen durch fremde Sprachen, und manche Importe gerade aus dem Englischen begrüssen wir. Unsere Initiative richtet sich allein gegen die schiere Anglomanie, gegen das Übermass.”
Anders gesagt:
- Englische Wörter werden in anderen Sprachen oft ungenau verstanden. Wenn sie aus Werbe-Interessen in die Welt gesetzt werden, verschleiern oder lügen sie sogar. Hier steht die Kommunikation zwischen Menschen in Frage. Meistens ist ein deutsches Wort deutlicher.
- Modische Wörter (egal woher sie kommen) können witzig sein, aber sie sind es umso weniger, je öfter sie nachgesprochen oder -geschrieben werden. Freie Persönlichkeiten werden entscheiden: Es ist besser, die eigene Sprache kreativ zu verwenden.
- Die deutsche Sprache hat eine grosse Geschichte und bietet vielfältige Möglichkeiten, etwas zu sagen. Sie kann und sollte sich gegen eine englische Welteinheitssprache behaupten und unsere Kultur beleben.
Aktion Lebendiges Deutsch: Angebote
Verein Deutsche Sprache
maximil
Themen: Allgemein · Kultur · Politik
4. März 2010
“Das Worte-Suchen verläuft im Schweigen, ohne Schweigen gibt es kein vernünftiges Sprechen. Was letzteres sei? Ein das Handeln nicht nur legitimierendes, sondern begründendes und verstehendes Sprechen, eine Benennung, die die Dinge weder ersetzt noch verbirgt, sondern hervortreten lässt.”
Barbara Sichtermann, “Die schweigende Mehrheit war weiblich”, in “Wer ist wie?”, Berlin 1987, S. 94
Themen: Allgemein · Kultur · Politik
2. März 2010
Es gehört einiges dazu, Politik und Schönheit zusammenzubringen. Die Politik, wie sie üblicherweise betrieben wird, ist für viele abstossend: Herrschaft, unter der die Beherrschten leiden; der obskure Kampf von Interessengruppen um Einfluss; Korruption; Verschwendung gemeinsam aufgebrachten Steuergeldes; Beschränkung auf Reparaturen und das Nötigste statt Einsatz für das Wichtige; Handeln gemäss angeblicher globaler Sachzwänge statt aufgrund gesellschaftlicher Bedürfnisse und humaner Möglichkeiten; dem gegenüber das verbreitete Gefühl, nicht mitbestimmen zu können. Und Schönheit? Die Meinungen über sie gehen auseinander (wie in der Politik), sind auch skeptisch, aber es gibt eine grosse Sehnsucht nach ihr. Sie ist nicht so leicht zu finden, sie wird in besonderen Augenblicken an Menschen erlebt, sonst eher am Rand der Gesellschaft, in der Natur, und sie begegnet in kulturellen Werken.
Damit ist umrissen, was es heisst, den Anspruch der Schönheit auf das Politische zu richten: Es kommt dabei auf Humanität, Ökologie und Bildung an, und zwar so, dass diese Werte nicht politisch instrumentalisiert werden, sondern Vorgaben sind. Im Namen der Schönheit können künstlerische Gegenstände und Inszenierungen deutlich machen, was menschenwürdig ist. Eine solche Initiative ist das Zentrum für Politische Schönheit. Die Beteiligten sind mit ihren Aktionen dabei, etwas zu bewirken.
Zentrum für Politische Schönheit
maximil
[Dazu:
Wird etwas besser?
Für Lust und Leben
Irritierend...]
Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
2. März 2010
Aufmerksam sein, bedenkenswert fragen, etwas zeigen, und auf diese Weise berühren und bewegen - das tut einer, der nicht angepasst ist, und nach seinem Verschwinden wird es deutlich und wirkt weiter.
“Über das Verschwinden”, Film, Regie und Buch Philipp Ruch, 2005, 16 min.
Über das Verschwinden (2005) von Politische Schönheit auf Vimeo
Aus solchem menschenwürdigen Verhalten kommt humane Politik.
maximil
Themen: Allgemein · Kultur · Politik
17. Februar 2010
Als das Fernsehen aufkam, hat sein Publikum damit einen immer grösseren Teil seiner Freizeit verbracht. Der Bildschirm öffnete in der Wohnung ein Fenster zur weiten Welt. Mit den Rechnern wurden Bildschirme an den Arbeitsplätzen aufgestellt, zunächst nur zu eng definierten Zwecken, dann multifunktional und vernetzt, und schnell sind die Computer auch ins Privatleben eingezogen. Viele Menschen leben inzwischen täglich stundenlang vor den Schirmen. Es ist angeraten, zu erkennen, was das bedeutet.
Wie verhalten sich Menschen am Rechner, dem Bildschirm gegenüber? Da die Geräte anders als das Fernsehen interaktiv sind, gibt es etwas zu tun. Deshalb wird hier zuerst das physische Verhalten beobachtet - nicht ein extremes, sondern der durchschnittliche Normalfall.
Arbeit mit den Fingerspitzen gibt es schon bei der Schreibmaschine, jetzt ist sie das Übliche: An verschiedenen Geräten werden Eingaben über Tastatur, Maus, Berührbildschirm oder Schalter erwartet, an Rechnern, Telefonen, Automaten für Geld oder Fahrkarten, Kassen, Steuer- und Registriergeräten - ausser wenn Daten mit einem Lesegerät erfasst werden. Die Finger werden beim Tippen und Klicken meistens gleichförmig von oben nach unten bewegt. Die Hände bewegen sich dabei und bei der Mausführung schematisch und auf engem Raum. Andere Fähigkeiten der Hände wie das Greifen - von dem sich das Begreifen ableitet - werden ausser bei der immer gleichen Maus nicht angewendet. Zielsicherheit und Ausdauer sind nötig, aber nicht Fingerspitzengefühl - das wird taub.
Das Wort “digital” kommt vom Zählen mit den Fingern; zum Rechnen werden die Hände so nicht mehr gebraucht, und auch vieles andere müssen sie nicht mehr können.
Zwischen der Eingabe und dem Ergebnis auf dem Schirm ist ein sinnlich nicht nachvollziehbarer Abstand. Das Ergebnis ist von verschiedenen Einstellungen (Formatierung etc.) abhängig und über das digitale Programm vermittelt, aber es hat nicht spürbar mit der normierten Hand- und Fingerbewegung zu tun.
Dem Bildschirm gegenüber ist der Blick auf ein Rechteck fixiert, oft im gleichbleibenden Abstand und stundenlang. Bei mobilen Kommunikationsgeräten ist das Sichtfeld klein. Die Darstellung ist zweidimensional. Anders als in der komplexen räumlichen Wirklichkeit ist die Sehtätigkeit sehr beschränkt und spezialisiert. Ton zum Hören ist dabei, andere sinnliche Fähigkeiten (Fühlen, Riechen, Schmecken…) werden nicht beansprucht.
Das Radio lässt dagegen viel mehr Freiheit für die Fantasie…
Die Körperhaltung vor dem Bildschirm ist insgesamt fast stillgestellt, der Mensch sitzt fest. Mit einem Buch oder einer Zeitung ist es anders: Lesen ist in verschiedenen Haltungen möglich, die Hände greifen und fühlen den Gegenstand, blättern um…
Bei interaktiven Geräten, besonders da, wo Automaten persönliche Beziehungen ersetzen, werden zudem die Besonderheiten und vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Kommunikation nicht mehr gebraucht, der Ton der Sprache, der gegenseitige Blickkontakt, Mimik und Gestik. Die Tendenz ist, dass sie nicht ausreichend geübt werden, oder sie werden sogar verlernt.
Die digitale Technologie standardisiert menschliche Handlungs- und Denkweisen. Die meisten üblichen Anwendungsprogramme sind inzwischen gleich aufgebaut und verlangen die gleichen Vollzüge: Datei öffnen - bearbeiten - Schreibmarke setzen - markieren - kopieren und einfügen - Datei speichern; es wird immer wieder aus “Menüs” ausgewählt und mit “Eingabe” ein Beschluss ausgeführt; es wird heruntergeladen statt im Laden erworben. Zum Vergleich: Diese Arbeitschritte gelten auch für die digitale Bildbearbeitung, während sich in einem analogen Fotolabor ganz eigene Materialien, Handgriffe und Abläufe fanden. Das vereinheitlichte Handeln wirkt sich auf das Denken aus. Ausdrücke für häufige Vorgänge am Rechner wie “Multitasking” für den schnellen Wechsel zwischen Programmen und Bildschirmfenstern wurden auf die menschliche Bewältigung von Alltagssituationen übertragen - das macht den Einfluss deutlich.
Das Wissen der Menschheit liegt im Netz; zumindest das, was als relevant gilt, und dazu viel, was eher als kollektives Unbewusstes anzusehen ist und oft chaotisch anmutet. Alles, oder jedenfalls das, was üblicherweise gebraucht wird, ist im Internet abrufbar. Damit eröffnen sich einerseits ungeahnte Möglichkeiten. Andererseits: Wir müssen sowieso zu viel wissen - jetzt müssen wir uns nichts mehr merken. Über die Schnittstelle zwischen Mensch und Suchmaschine beziehen wir nach Bedarf Informationen, die wir meistens schnell wieder vergessen können, weil sie nur kurze Zeit aktuell sind. Das individuelle Gedächtnis schrumpft. Darin bleiben vielleicht noch persönliche Erinnerungen, an Erlebnisse, Begegnungen, Erfolge, Kränkungen, Genüsse. Früher wurde viel auswendig gelernt und war jederzeit präsent, Menschen konnten Geschichten erzählen, die sie nicht selbst erlebt, aber nachvollzogen hatten, sie sagten Gedichte auf, hatten historische Daten parat. Heute gibt es noch die erlebten Geschichten, aber wer kann auch nur einigermassen überzeugend die Geschichte eines gerade gesehenen Films wiedergeben?
Wenn das Gedächtnis fehlt, ist das Denken behindert. Denn das Denken braucht als Grundlage Wissensdaten, die es verbinden oder unterscheiden kann. Die müssen unmittelbar vorhanden sein - wenn sie erst technisch besorgt werden müssen, ist der Gedankengang unterbrochen. Überhaupt ist das Denken orientierungsgestört, wenn sich im Gedächtnis nicht schon Fakten und Beurteilungen zu einer Struktur angeordnet haben. Stattdessen spontanen Informationsimpulsen zu folgen, kann interessant sein und auch zu einer assoziativen Struktur führen, aber die wird ziemlich zufällig und beliebig. Übersicht und Durchblick werden so nur ausnahmsweise zustande kommen.
Die Beziehungen zwischen Menschen verändern sich. Im Netz pulsiert die Kommunikation. Weltweit gibt es schnelle Kontakte, Botschaften erreichen sofort ein globales Publikum. Allerdings sehen sich die Beteiligten meistens nicht, sie erleben nicht eine räumliche Begegnungssituation mit ihrer natürlichen und wichtigen Komplexität. Die grosse Masse der Aussagen in Foren und Blogkommentaren ist zudem banal, oberflächlich, nichtssagend. Die “Gemeinschaften”, die entstehen, sind vielfach fiktiv. Das Gefühl, dazuzugehören, ist dann kaum tiefgehend.
Das Vorgegebene im Netz, Texte, Bilder, Musik, ersetzt ausserdem sozialen Austausch im wirklichen Leben. Wir müssen niemanden fragen, mit niemandem diskutieren, mit niemandem etwas ausmachen. Vor dem Bildschirm sind wir allein - vor dem des Rechners noch mehr als vor dem (bisher noch getrennten) des Fernsehgeräts, das mit seinem festen Sendeprogramm oder einem vorrätigen DVD-Film noch gemeinsames Schauen veranlassen kann. Die menschliche Isolierung an den Bildschirmen reduziert am Arbeitsplatz und in der Freizeit sowohl soziale und kommunikative Fähigkeiten als auch die daraus sonst entstehenden Gewinne an Erfahrung, Selbstbewusstsein, Bildung und Gemeinschaftserleben.
Die Rechner und ihre Infrastruktur sind selbstverständlich Mittel für die Rationalisierung der Arbeit. Maschinen haben zunächst körperlich anstrengende und dreckige menschliche Arbeit übernommen. Dann sind durch die Rechner Arbeitskräfte in den Büros überflüssig geworden. Der Kampf um die Arbeitsplätze - den es bei entsprechend kürzerer Arbeitszeit für alle gar nicht geben müsste! - bringt Unsicherheit, Druck, Ängste, noch intensivere Vereinzelung mit sich, die weiteren Folgen sind Zwänge zu übermässiger Flexibilität und Mobilität. Dass es heute bei beruflicher Tätigkeit in der Ferne leichter ist, mit der Familie, den Freunden und Kolleginnen in der Heimat zu kommunizieren, ist nur ein schwacher Ausgleich. Wer keine Arbeit mehr hat, kann sich verstärkt dem Rechner daheim widmen.
Hier soll nicht die Rede sein von Internetsucht, Kriminalität im Netz, Datenmissbrauch, weil dafür die Technologie nicht Ursache ist und etwas dagegen getan werden kann, privat, rechtlich oder politisch.
Aber wie sollen wir mit dem alltäglich gewordenen Netz umgehen? Kaum jemand wird sich problemlos anpassen, und das sollten wir auch nicht. Angebracht ist eine gewisse Distanz, räumlich und kritisch: immer wieder rechtzeitig vom Schirm wegsehen, weggehen, eine Pause machen. Auch mal mit Stift und Papier schreiben, ein Buch lesen. Sich selbst fühlen und es spüren, wenn eine andere Beschäftigung wohler täte. Mit anderen Menschen zusammen sein. Es gibt ein Leben ausserhalb des Netzes…
maximil

Themen: Allgemein · Kultur
1. Februar 2010
Wenn die Sprache nicht funktioniert, ist die Kommunikation gestört, und Menschen kommen noch weniger miteinander klar als so schon. Sprache muss verständlich sein. Sie muss sich an Regeln halten - ohne oder gegen die Spielregeln kann sie zwar poetisch werden, aber das gemeinsame Spiel ist erst mal unterbrochen. Das richtige Wort an der passenden Stelle: So wird die Botschaft übermittelt.
Oft wird auch schriftlich nur geplaudert, ohne besondere Inhalte, zugunsten des sozialen Zusammengehörigkeitsgefühls. Wer darüber hinaus etwas sagen will, wird auf den Inhalt achten und bewusst sprechen. Um sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und Gedanken oder Gefühle auszudrücken, bietet die Sprache differenzierte Möglichkeiten, die wahrgenommen werden sollten.
Modische Ausdrucksweisen übertragen eher Stimmungen als Bedeutungen. Solche Wörter und Wendungen werden meistens nicht bewusst verwendet, sondern nachahmend und aus Gewohnheit, und sind deshalb undeutlich. Häufig werden derartige Formulierungen, die überwiegend aus dem Englischen kommen, unverstanden benutzt - dagegen wären entsprechende deutsche Wörter viel aussagestärker.
Es gibt globale, nationale, regionale, lokale Sprachen - und die persönliche Sprache. Je mehr sich Sprachen vereinheitlichen und Anpassung verlangen, desto wichtiger wird es, die eigene Sprache zu finden, sie wertzuschätzen und zu gestalten.
maximil
Themen: Allgemein · Kultur
1. Januar 2010

“Divadlo Zahrada” (”Garten-Theater”), Broumov, Tschechien
Themen: Allgemein
17. Dezember 2009
Der Titel der Ausstellung “Gegen jede Vernunft. Surrealismus Paris - Prag” in Ludwigshafen ist irreführend. Die Bewegung des Surrealismus richtet sich jedenfalls von ihren ursprünglichen Absichten her nicht gegen die Vernunft. Sie wendet sich gegen ein falsches Verständnis davon, das autoritär oder aus Gewohnheit die Wahrnehmung beschränkt und damit die Vernunft behindert.
Mit dem Ausstellungstitel wird die Definition des Surrealismus in André Bretons Manifest von 1924 missverstanden. Sie besagt, dass sich das Denken “ohne jede Kontrolle durch die Vernunft” äussert. Entsprechende Verfahren sollen die Wahrnehmung befreien. Was dabei entdeckt wird, ist dann der Vernunft zugänglich, die es für das menschliche Leben auswertet. Mit Bezug auf Sigmund Freud, einen rationalen Denker, formulierte Breton: “Wenn die Tiefen unseres Geistes fremde Kräfte verbergen, die zu denen an der Oberfläche hinzukommen oder sie bekämpfen und besiegen können, dann besteht grosses Interesse daran, diese Kräfte zu fassen, sie erst einmal zu fassen zu bekommen, um sie danach gegebenenfalls der Kontrolle unserer Vernunft zu unterwerfen.”
Aber nehmen wir an, dass die sehenswerte Ludwigshafener Ausstellung surrealistisch provozieren will.
Sie zeigt besonders die Breite und Vielfalt des Surrealismus in der früheren Tschechoslowakei und die Beziehungen seiner Aktiven zur Szene in Frankreich. Es bleibt zu klären, was Surrealismus im Raum zwischen diesen Ländern, also in Deutschland, bedeutet.
 André Breton, “Manifeste des Surrealismus”, Rowohlt TB 2009, 9,95 €
André Breton, “Manifeste des Surrealismus”, Rowohlt TB 2009, 9,95 €
maximil
[Bezieht sich auf Surreales entdecken]
Themen: Allgemein · Kultur · Politik