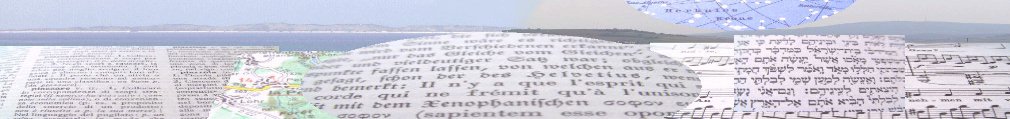22. November 2015
Ungelöste Konflikte? Mangelnde Zusammenarbeit? Misslungene Kommunikation? Vieles ginge besser mit Empathie: wenn Beteiligte sich in ihr Gegenüber hineindenken.
Es ist schon eine lebenslange Aufgabe, sich selbst zu verstehen. Die alte griechische Religion hat den Ratsuchenden am Apollo-Tempel in Delphi und in der Folge der europäischen Kultur empfohlen: Erkenne dich selbst! Zumindest in einzelnen Situationen die eigenen Interessen, Motive und Gründe einigermassen deutlich zu sehen, hilft beim Umgang mit anderen Menschen sehr. Damit wird es leichter, sich verständlich zu machen. Und wenn ähnliche Eigenschaften auch beim Gegenüber zu finden sind, ist es ebenfalls leichter zu verstehen. Beide Seiten können einander näherkommen.
Empathie heisst: Ich kann einen Mitmenschen verstehen, seine Gefühle wahrnehmen, mich in ihn oder sie hineinversetzen. Das geht manchmal spontan, manchmal ist es äusserst schwierig. Dennoch versuche ich es, gerade wenn ich zunächst wenig Gemeinsames sehe. Eine Aussage oder Handlung kann sehr verschieden gemeint sein. Ich bedenke die Umstände, den Hintergrund, den Kontext, frage möglicherweise gezielt nach. Dabei will ich mir mein Bild der oder des anderen nicht wie ein Vorurteil bestätigen lassen, sondern vorsichtig herausfinden, was tatsächlich stimmt. Dann kann ich angemessen reagieren, und es zeigt sich am ehesten, wo wir uns einigen können.
—————————————————–

Ruinen des Apollo-Tempels und des Theaters in Delphi, Griechenland - Foto: F. Harbin, Wikimedia Commons, Lizenz CC-BY-3.0
—————————————————–
In einem Konfliktgespräch wird oft aneinander vorbeigeredet, die Fronten verhärten sich, oder der Streit eskaliert. Um die Chancen für ein Ergebnis zu erhöhen, ist es nützlich, die Argumente der anderen Seite fragend und überprüfend in eigenen Worten wiederzugeben: „Willst du damit sagen, …?“, „Verstehe ich Sie richtig, dass …?“, „Kommt es dir darauf an, …?“ Insbesondere kann es weiterführen, wenn nach den Gefühlen des Gegenübers gefragt wird: „Sind Sie verärgert über …?“, „Fühlst du dich benachteiligt, weil …?“, „Empfindest du als Mangel, dass …?“ Dies entspricht dem gruppendynamischen Konzept des „Kontrollierten Dialogs“.
Ohne Mitgefühl ist in Konflikten das Risiko gross, dass sie in Gewalt ausarten. Wer nur die eigenen Ansprüche, Wünsche und vermeintlichen Rechte kennt, isoliert sich sozial und ist eher bereit zum Beleidigen, Verletzen, schliesslich zu Tätlichkeiten. Immer wenn es weniger dramatisch um Zusammenarbeit geht, beispielsweise unter Kolleginnen und Kollegen, hat fehlendes Mitgefühl Missverständnisse, Störungen und Verweigerung zur Folge, Potenzial wird nicht genutzt. Umso mehr Anlass gibt es zu überlegen, wie Empathie gelernt werden kann.
Empathie ist eine natürliche Eigenschaft. Schon kleine Kinder zeigen sie, sind traurig mit anderen und lachen mit ihnen, wollen dann auch trösten, helfen, teilen. Unwillkürlich wird die Mimik eines Gegenübers nachgeahmt, und damit verbindet sich das entsprechende Gefühl. Das Zusammenleben braucht empathisches Verhalten, unter normalen Bedingungen und besonders in schwierigen Umständen, in Konflikten und Krisen. Tiefenpsychologisch gesehen haben alle Menschen Anteil am kollektiven Unbewussten, das die Gemeinschaft trägt. Während Kräfte wie die aktive Empathie Leben und Entwicklung fördern, wirken dem hemmende und zerstörende Kräfte entgegen.
Ein Kind, das von seinen Eltern oder anderen Bezugspersonen kein Mitgefühl erfährt, das vernachlässigt wird oder Hilflosigkeit erlebt, wird wahrscheinlich wenig empathisch werden. Liebe ist nicht immer mitfühlend, sie kann selbstbezogen sein, doch als kommunikative Zuwendung ist sie vor allem für Kinder das entscheidende Lebensmittel. Wenn die Eltern sie nicht geben können, sollten ihre Kinder Menschen anvertraut werden, die dazu imstande sind. Kitas mit ausreichend Fachkräften, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können, bieten zudem ein Gemeinschaftsleben mit empathiefördernden Erfahrungen. Das ist auch für viele Einzelkinder wichtig. In zahlreichen Fällen wäre es für die Kinder am besten, zusammen mit den Eltern in sozialpädagogisch unterstützten Wohngemeinschaften zu leben. Denn jedem Kind steht das Recht zu, vermittelt zu bekommen, womit es eine beziehungsfähige, in vielfältigem Austausch lebende Persönlichkeit werden kann.
Vorhandene Empathie wird durch Autoritätsgläubigkeit oder Gruppenzwang eingeschränkt, manchmal sogar ausser Kraft gesetzt. Das hat das „Milgram-Experiment“ von US-Wissenschaftlern 1961, das später in Deutschland als „Abraham-Versuch“ nachvollzogen wurde, sehr deutlich gemacht. Ausgehend von Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus sollte untersucht werden, wie weit Menschen in bestimmten Situationen gegen ihr Gewissen handeln. Ein Grossteil der darüber nicht informierten Versuchspersonen löste immer stärkere Elektroschocks aus, obwohl Schmerzen und Leiden des Opfers zurückgemeldet wurden – weil der Versuchsleiter das im Namen der Wissenschaft verlangte. In einem Herrschaftsverhältnis fühlen sich die Abhängigen weniger verantwortlich. Festgestellt wurde auch: Je näher der von Gewalt betroffene Mensch ist, desto mehr wirkt beim Handelnden zumeist das Mitgefühl.
Angehörige einer Gruppe haben Sympathien für die anderen Mitglieder aufgrund gemeinsamer Einstellungen, Werte oder Interessen und handeln deshalb solidarisch, müssen aber dabei nicht verständnisvoll oder einfühlsam sein. Stattdessen können sie sich gegen Aussenstehende, „Fremde“, andere Gruppen misstrauisch bis aggressiv verhalten und Feindbilder pflegen. Geboten sind aber Toleranz und Respekt, damit es gelingt, einander zu begegnen und kennenzulernen. Vertrauen ist die Grundlage für konstruktive Beziehungen.
Mitleid ist hilfreich nach der Formel „Geteilter Schmerz ist halber Schmerz“. Es sollte sich nicht unbedacht als Geste von oben herab äussern und damit vor allem dem eigenen Ego dienen. Das mögen beispielsweise Menschen mit Behinderungen nicht. Empathisch ist es, auf Bedürfnisse Benachteiligter einzugehen, wie etwa gleicher Zugang zu Räumen, Rechten und Chancen.
Identifikation mit einem anderen Menschen ist ähnlich wie Anpassung für empathisches Verhalten eher nachteilig, weil dabei der für achtsames und kritisches Wahrnehmen nötige Abstand fehlt. Anderenfalls werden mehr oder weniger bewusst wahrnehmend immer wieder die bisherige Erfahrung und die gewonnene Menschenkenntnis herangezogen.
In der modernen Gesellschaft ist Empathie schwieriger geworden. Das ist verursacht durch die sozialen Veränderungen, die herkömmliche Gemeinschaften wie Partnerschaften von Männern und Frauen, Familien, Nachbarschaften, Belegschaften von Unternehmen lockern und auflösen, wobei sich neue Gemeinschaften weniger verbindlich, flexibler und für kürzere Dauer bilden. Zugleich werden die Menschen individualistischer und entfremden sich dadurch voneinander. Hinzu kommen verstärkter Leistungsdruck und Wettbewerb, die egoistische Einstellungen und Rücksichtslosigkeit begünstigen. Jedoch wird Empathie auch zunehmend als Aufgabe gesehen. Die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft bleibt.
Empathie verbessert die Kommunikation. Wie diese wird sie statt zum beiderseitigen Vorteil auch zu manipulativen Zwecken angewendet. Wer andere durchschaut, ihre Motivationen kennt und ihre Reaktionen vorhersieht, kann sie kontrollieren und steuern. Deshalb ist es wichtig, den privaten Bereich zu schützen.
Unternehmen und Regierungen wissen schon viel über uns, durch klassische Marktforschung, Demoskopie und inzwischen vor allem aus den Datenmengen des Internets, und sie verwerten die Informationen in ihrem Sinn. Es ist harmlos, dass die Wirtschaft mit personalisierter Werbung Umsätze steigern will. Unser Leben beeinflusst dagegen massiv, dass sogenannte Denkfabriken, also Institute zur Beratung von Wirtschaft, Politik und Medien, ganze Bevölkerungen kontinuierlich beobachten und aus der Analyse von deren Einstellungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Stimmungen die geeigneten Strategien ableiten, um Macht zu sichern und demgemäss die Gesellschaft zu formen. Denn die Mächtigen haben mit ihrem Wissen über die Menschen längst die modernen Gesellschaften in effizienter Weise ungerecht, antiökologisch und demokratiefeindlich verändert. Dem müssen die Betroffenen das gesammelte Wissen über die Macht entgegensetzen, wozu besonders Transparenz des Lobbyismus und des staatlichen Handelns beiträgt.
—————————————————–
“Freiheit im tiefsten Sinne des Wortes bedeutet (…) mehr, als ohne Rückhalt zu sagen, was ich denke. Freiheit bedeutet auch, dass ich den anderen sehe, mich in seine Lage hineinzuversetzen, in seine Erfahrungen hineinzufühlen und in seine Seele hineinzuschauen vermag und imstande bin, durch einfühlsames Begreifen von alledem meine Freiheit auszuweiten. Denn was ist das gegenseitige Verständnis anderes als die Ausweitung der Freiheit und die Vertiefung der Wahrheit?”
Václav Havel, Staatspräsident von Tschechien und Schriftsteller, am 24.4.1997 im Deutschen Bundestag
—————————————————–
In einem anderen Bereich wirkt Empathie heilend: wenn Fachleute für Krankheiten und Krisen die leidenden Menschen besser verstehen als diese sich selbst. Sie hören zu, folgen ihrer Intuition, erspüren mit hoher Sensibilität die Persönlichkeit ihres Gegenübers ganzheitlich. Die entsprechenden einvernehmlichen Therapien und Beratungen werden wahrscheinlich gelingen.
Theaterspielen, auf einer Bühne oder sonst im Leben eine Rolle übernehmen, das setzt empathische Kompetenz voraus und übt sie. Je bewusster die schauspielende Person eine andere darstellt, desto deutlicher wird für sie deren Eigenart mit Unterschieden wie Ähnlichkeiten. Dass sie in einer anderen, stimmigen und glaubwürdigen Rolle die Perspektive wechselt, ist befreiend und erweitert die Möglichkeiten des Zusammenlebens.
Es geht aber auch ohne Aktion, an einem ruhigen Ort – im Meditieren lassen sich andere Menschen und das Verbundensein mit ihnen empfinden.
Matthias Kunstmann / maximil

Themen: Allgemein · Kultur · Politik
7. Oktober 2015
… bereichert die Welt mit einer ungewöhnlichen Darstellung oder einer besonderen Geschichte, lässt Erfahrungen nachvollziehen, verwertet die Möglichkeiten der Sprache in einem treffenden und auch schönen Stil – wobei es mich auf neue eigene Gedanken bringt, sodass das Lesen Folgen hat und ich mit dem Geschriebenen etwas anfangen kann.
> Drei Fragen an Lektoren und Lektorinnen mit Antworten
im Bücher-Blog buchstaebliches.de
Matthias Kunstmann / maximil
Themen: Allgemein · Kultur
21. Juli 2015
Liebe nach dem ökonomischen Prinzip wäre nicht das Wahre. So ist das bei vielem, was zum Glücklichsein wichtig ist: Es lässt sich nicht berechnen. Das rationale Denken, das in Europa entwickelt wurde und sich überall durchzusetzen versucht, will jeden Bereich des Lebens messen, in Geld bewerten und wirtschaftlich beurteilen, mit dem Risiko, schweren Schaden anzurichten. Wenn Bildung, Gesundheit oder das Soziale nur gefördert wird, um einen kurzfristigen finanziellen Nutzen zu erzielen, dann wird das Bedeutsamste missachtet. Aber das freie Denken, das menschliche Werte kennt, ist wach und wirkt der Ökonomisierung der Welt entgegen.
Achtet auf das Wertvolle, das es nicht zu kaufen gibt, ist ein guter Rat. Ein weiterer: Nehmt wahr, was ihr wirklich braucht - vielleicht eine Aufgabe, oder Zugehörigkeit, Freundschaft, Erkenntnis, Klarheit, Ruhe, Natur, Schönheit … Wer sich mit solchen Entdeckungen beschäftigt, hat weniger Bedarf an Konsum und handelt bewusster. Der materielle Luxus der Wohlstandswelt wird dann eher als hinderlich und störend empfunden. Wachstum ist dann keines mehr der Menge und Masse, sondern zum Beispiel das der Persönlichkeit oder der Gemeinschaft.
Produzieren im Übermass bis zur Sinnlosigkeit, entsprechend Verbrauchen ohne Bedacht bis zur Verschwendung sowie Reichwerden der einen auf Kosten der anderen bis zur Perversion folgen einer Ideologie, die sich in der Werbung ausdrückt. Multimediale Reklame markiert die westliche Zivilisation seit der Industrialisierung und ihrer Massenproduktion, und sie besetzt jeden verfügbaren Raum. Sie spricht Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte an, die über den praktischen Nutzen der Produkte weit hinausgehen: Lebensfreude, Anerkennung, Sicherheit, Erfüllung, Glück …, gerade das, was sich mit Geld nicht anschaffen lässt. Somit verspricht die Werbung immer wieder mehr, als die Angebote halten können. Indem Waren und Dienstleistungen als Ersatzbefriedigungen angenommen werden, wird um Marken und Objekte Kult inszeniert.
Da ist es aufklärerisch, Werbung mit Information und Gegenkampagnen (Adbusting) zu konfrontieren. Und es ist befreiend, Werbeanlagen (ausser für die ansässigen Geschäfte) von öffentlichen Plätzen zu verbannen, wie es die französische Grossstadt Grenoble vormacht. Dort hat eine neue, bürgerschaftliche und ideenreiche Mehrheit im Stadtparlament beschlossen, den Menschen und ihren Sichtweisen den Raum, das Panorama und die Gestaltungsmöglichkeiten zurückzugeben. Anstelle weltweit gleicher Werbebilder von Konzernen werden die Eigenart der Stadt, ihre Initiativen und ihre Kultur gestärkt - und damit auch die eigene Wirtschaft.
> Bitte keine Reklame! (Stadt Land Glück - BUND)
> Grenoble libère l’espace public et développe les expressions citoyennes (französisch)
maximil
[Dazu:
Geld fehlt Wert
Was tun für gutes Leben?]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
5. Mai 2015
“Was der Kapitalismus als Freiheit verkauft, erfüllt nicht die Bedingungen von Freiheit. Denn diese Freiheit gilt nicht für alle, was Voraussetzung echter Freiheit wäre. Wenn ich mir die Arbeitsbedingungen anschaue, sehe ich überall Freiheitseinschränkung und Freiheitszerstörung. Wie steht es also mit dem Freiheitsideal des Westens? Die These ist: Diese Freiheit ist nur eine Behauptung. Die westliche Ideologie setzt ein bestimmtes Prinzip, das Prinzip der Profitmaximierung, an die Stelle der Freiheit. Das ist nicht die Erfüllung von Freiheit, sondern eine Ideologie, die Ideologie des Egoismus. Sie liefert überhaupt keine Identifikationsmöglichkeit für die Menschen. Wofür soll sich denn ein junger Mensch begeistern? An welcher Idee soll sie oder er sich denn entzünden, wenn sie oder er auf den Westen schaut?”
Johannes Stüttgen / Omnibus für direkte Demokratie, in: mdmagazin 1.2015,
S. 22 f.
Themen: Allgemein · Politik
27. März 2015
Gutes denken und tun,
- damit ein Mensch zu sich stehen kann,
- damit wir miteinander zurechtkommen,
- damit wir glücklich werden können …
> Portal für Ethik und achtsames Leben
maximil
[Dazu:
Richtig leben - wie das gehen kann
Was tun für gutes Leben?]
Themen: Allgemein
10. Februar 2015
Frei sein, sagen, was wir denken, handeln, wie wir wollen - das gehört zu den Menschenrechten. Aber wir dürfen nicht alles sagen oder tun, denn unsere Freiheit endet vor den Rechten der Mitmenschen. Deshalb geht es nicht, jemanden zu beleidigen, gegen Bevölkerungsgruppen zu hetzen, religiöse oder weltanschauliche Ansichten zu beschimpfen und damit das Recht auf Menschenwürde zu verletzen. Wie eine bestimmte Meinung geäussert wird und wirkt, das ist vernünftigerweise nicht beliebig frei.
Jeden Terror gegen Meinungen wird eine rechtlich gesinnte Gesellschaft bekämpfen. Dabei ist einiges zu bedenken. Möglicherweise genügt es, so wie bei anderen Gewaltverbrechen konsequent die Gesetze anzuwenden. Die polizeilichen Mittel können auch neue Anschläge verhindern. Über dies hinaus werden viele, die sich angegriffen sehen, für freiheitliche Werte zusammenstehen.
Viele wollen sich aber nicht zugleich mit den angegriffenen Meinungen identifizieren. Dies ist auch weder nötig noch nützlich. Ebenso ist es nicht angemessen, Opfer des Terrors nachträglich zu Helden der Meinungsfreiheit zu ernennen. Damit wird in bekannten Fällen der Gewalt gegen Urheber antireligiöser Karikaturen eine falsche Front verfestigt: westliche Freiheit gegen islamische Aggression.
Diese Front ist nicht von der islamischen Welt verursacht. Vielmehr wurde sie von westlichen Medien mit aufgebaut, die ihre Meinung für überlegen halten, sich arrogant über andere Meinungen lustig machen, Zerrbilder religiöser Anschauungen zeichnen und damit andere Mitglieder der Weltgemeinschaft im In- und Ausland beleidigen, oft aus einer materialistischen Ideologie heraus. Medien, die solches verbreiten, begleiten die politischen Aggressionen mächtiger westlicher Konzerne und Staaten in vielen Gebieten der Welt, wenn es um Öl, sonstige Rohstoffe, Absatzmärkte und Kontrolle geht, seit dem Beginn des Kolonialismus bis heute.
Westlichem Terror bei militärischen Kampfeinsätzen und Drohnenangriffen fallen Menschen zum Opfer, die nicht wissen, warum. Während dergleichen eigene Taten und Wirkungen als normal gelten oder gar nicht mehr gesehen werden, wird die Schuld am Konflikt den Angehörigen anderer Kulturen angelastet, die in ihren Lebensweisen und Rechten verletzt sind und darauf auch mit Gewalt reagieren. So wird Eskalation betrieben, statt die Beziehungen anständig zu regeln. Ein Beispiel dafür ist die Politik der EU und der NATO in der Ukraine. Am schlimmsten wirkt aber seit Jahrzehnten der vom Westen gedeckte Umgang Israels mit dem palästinensischen Volk, der fortdauernd gegen die Menschenrechte, das Völkerrecht und alle Vernunft verstösst.
Es ist berechtigt und wichtig, Kritik und Satire gegen Missstände zu richten. Selbstverständlich setzen wir uns mit problematischen Meinungen, Denkweisen und Haltungen auseinander, insbesondere wenn sie Einfluss und Folgen im Zusammenleben haben. Auch über Religionen und andere Weltanschauungen muss diskutiert werden können, über Verhaltensweisen, die nicht zu den Aussagen passen, über Politik, die religiöse Anschauungen missbraucht oder ideologisch festgefahren ist. Aber die Menschenwürde ist zu achten, sie kommt sogar noch einem Verbrecher zu und erst recht denjenigen, die anderen nichts angetan haben.
Auf überzogene Kritik, Polemik oder Spott werden Betroffene, die souverän sind, nicht in gleicher Art antworten. Wenn sie nicht persönlich angesprochen sind, können sie darüber hinwegsehen. Sie können tolerant sein, auch wenn die andere Seite nicht tolerant ist. Wo Meinungen Gewalt ausdrücken oder zu Gewalttaten führen, ist Toleranz jedoch nicht mehr angebracht. Wünschenswert sind immer gute, konstruktive Argumente, Versuche, sich zu verständigen und Lösungen zu finden. Streit mag Spass machen, manche ziehen ihn mit Lust in die Länge - für alle sinnvoll ist es aber, dass Feindbilder abgehängt werden, Aufwand und Risiken eskalierender Konflikte wegfallen, Austausch zustande kommt. Nur so ist verlässliche Sicherheit zu haben. So können wir miteinander leben. Im “öffentlichen Frieden”, den unser Recht vorsieht.
Sylvie Natalicia
[Dazu:
Wirksamer Einsatz für Menschenrechte und Demokratie]

Themen: Allgemein · Kultur · Politik
28. Januar 2015
“Wegweiser
[...]
Wenn der Weg zum Recht und zur Zukunft
dunkel ist und verborgen
dann halte ich mich an das Unrecht
das liegt sichtbar mitten im Weg
und vielleicht wenn ich noch da bin
nach meinem Kampf mit dem Unrecht
werde ich dann ein Stück
vom Weg zum Recht erkennen”
Erich Fried, Gesammelte Werke, Gedichte Band 2, Berlin 1993, S. 68
Themen: Allgemein · Kultur · Politik
24. November 2014
Menschen leiden unter ihrem Seelenzustand.
Wenn er wechselt, wird die Stimmung wieder besser.
Wenn er übermässig schmerzt, ist der Mensch psychisch krank.
Sobald die Krankheit das Zusammenleben mit anderen Menschen stört, schmerzt sie mehr.
In vielen Fällen ist die Seele belastet, weil zwischen Menschen etwas nicht stimmt.
Die sogenannten Verrückten gehörten in früheren Jahrhunderten zu den Lebensgemeinschaften der europäischen Dörfer und Städte. Es ist wünschenswert, miteinander auszukommen, das erleichtert das Dasein. Trotzdem ergeben sich Konflikte, Streit und Nervereien, aus den verschiedensten Ursachen. Ob jemand aus einer Krankheit heraus, durch seinen Charakter, aus bewusster Absicht oder aus anderen Gründen die Mitmenschen belästigt, das nehmen die vielleicht wahr, es macht für sie aber kaum einen Unterschied; oft genug unterstellen sie dem oder der anderen etwas und erkennen nicht, dass sie selbst den Anlass für Ärger geboten haben. Wie auch immer, die Gemeinschaft versucht, den Konflikt irgendwie zu regeln.
Was verrückt ist und was normal, ist zu allen Zeiten eine Ansichtssache gewesen. Die jeweilige Mehrheit hat es bestimmt oder geglaubt. Solche Grenzziehungen sollen in der Nachbarschaft gelten und ebenso in der grossen Politik.
Seit etwa dem Jahr 1800 hat idealistisches und wissenschaftliches Interesse dazu geführt, psychisch Leidenden gezielt zu helfen. Zugleich wurden solche auffälligen Menschen immer genauer definiert und in speziellen Anstalten von der Allgemeinheit abgesondert. Bis heute kann in Deutschland und vielen anderen Ländern ein Insasse der Psychiatrie weniger Aussichten haben als ein zurechnungsfähiger Strafgefangener, wieder in Freiheit zu leben.
Human geplant und organisiert, aber in der Praxis brutal und die Krankheit verschlimmernd, jedenfalls eine eigene Welt, in der die Patienten und Patientinnen unter sich waren und am Leben der Gesellschaft nicht teilnehmen konnten, das war auch das Ospedale psichiatrico San Giovanni, eine Gebäudegruppe mit Grünflächen an einem Berg über der italienischen Hafenstadt Triest. Ungefähr 1200 Kranke waren dort in den 1970er-Jahren hinter Mauern und Gittern untergebracht, als derartige Einrichtungen vielerorts immer mehr in die Kritik gerieten. Es wurde bewusst, dass sie die Menschenwürde verletzten. Der Psychiater Franco Basaglia, der diese Erkenntnis aus seinen Erfahrungen vertrat, wurde damals der Leiter der Anstalt.
Zunächst öffnete er die Abteilungen. Insassen und Personal kamen gemeinschaftlich ins Gespräch, psychiatrisch und pflegerisch Tätige bekannten sich zu dem, was sie mit den klinisch Leidenden verbindet, miteinander veranstalteten sie Kulturereignisse. Um zusammen neue Perspektiven zu gestalten, wurden der Schriftsteller und Regisseur Giuliano Scabia und der Bildkünstler Vittorio Basaglia, ein Vetter des Psychiaters, in das Ospedale eingeladen.
Mitbewohner der Anstalt war ein alt gewordenes Pferd, das auf einem Karren die Wäsche über das Gelände transportierte. Für viele war es ein Freund. Die zuständige Behörde kündigte an, es werde durch ein Motorfahrzeug ersetzt und in den Schlachthof gebracht. Die betroffenen Menschen zeigten daraufhin auch ausserhalb der Anstaltsgrenzen, was sie wollten: In einem Schreiben an das Amt forderten sie, das Pferd leben zu lassen. Sie hatten Erfolg, ihm wurde zur Rente ein städtischer Stallplatz gewährt.
Dies war der Anlass dafür, dass die Künstler mit den Patientinnen und Patienten von San Giovanni ein überlebensgrosses Pferd aus Holzkisten und Pappmaché schufen, es blau bemalten und Marco Cavallo nannten, das Pferd Marco. Es wurde ein Symbol, für die Kräfte der Schwachen, die Eigenart, die Gemeinsamkeit, die Sehnsucht, das Leben.

Und schliesslich für das Freisein. Dies entwickelte sich in Meditationen, Gedichten, Geschichten, Liedern, Bildern, Inszenierungen rund um das blaue Pferd. An einem Frühlingstag 1973 zogen die Menschen mit Marco Cavallo aus der Anstalt hinaus in die Stadt. Sie brachen die obere Begrenzung eines Zauntores ab, damit sie hindurchkamen. Mit vielen Menschen von draussen ging der Zug durch die Strassen von Triest zu einem Platz, auf dem sie miteinander feierten, bei Musik und Tanz.
Das italienische Parlament beschloss fünf Jahre später ein Gesetz, das die psychiatrischen Kliniken auflöste. Menschen mit psychischen Leiden sollen seither als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft leben können, in ihren Familien oder eigenständig, und dabei von Fachkräften unterstützt werden, die ihnen Rat, Therapie und den jederzeitigen Zugang zu ambulanten Diensten oder Treffen bieten: offene Türen, Inklusion und Empathie. In der Realität bestehen da weiter Defizite. Aber diese Psychiatrie erscheint in Italien als grundsätzlich richtig.
Mit seiner Botschaft ist Marco Cavallo über das Land hinaus in Europa unterwegs gewesen. In Deutschland hat er das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten aufgegriffen, Esel, Hund, Katze und Hahn, deren Existenz in fortgeschrittenem Alter bedroht ist, worauf sie optimistisch aufbrechen, um gemeinsam eine gute Zeit zu erleben. Eine Initiative am anderen Ende des Kontinents, in der Hafenstadt Bremen, hat dann ein schwimmendes blaues Kamel entstehen lassen, auch dieses eine zeichenhafte Figur für das Überschreiten von Grenzen und Ausgrenzungen, für Vielfalt und für die Möglichkeiten des Zusammenlebens.
In Triest ist die frühere Anstalt San Giovanni heute ein offenes Gelände, in den Gebäuden forscht und lehrt die Universität, arbeitet das Stadttheater, sind auch Räumlichkeiten des Dienstes für geistige Gesundheit. Es ist beschlossen worden, dass das blaue Pferd Marco als Denkmal einen Platz in der Stadt bekommt.
Matthias Kunstmann / maximil
> Die blaue Karawane

Themen: Allgemein · Kultur · Politik
14. Oktober 2014
Die Zeit fliesst. Zeit vergeht. Zeit verstreicht. Zeit verrinnt. Zeit fehlt. Zeit kommt. Zeit drängt. Die Zeit scheint stillzustehen. Die Zeit heilt alle Wunden.
Und was tun wir mit der Zeit - oder (allgemeiner) mit Zeit? Zeit brauchen. Zeit haben. Zeit verbringen. Zeit verschwenden. Zeit verlieren. Zeit gewinnen. Zeit nutzen. Sich Zeit nehmen. Jemandem Zeit geben. Zeit schenken. Zeit sparen. Zeit einteilen. Der Zeit entfliehen. Die Zeit geniessen. Mit der Zeit umgehen. Zeit erleben.
Das sind Möglichkeiten. Verschiedene Begegnungen mit der Zeit ereignen sich auch in den Medien, nicht nur in Zeitungen und Zeitschriften. Das Medium Film kann in einem bestimmten Zeitablauf mit Bild und Wort freie, wunderbare, bewegende Geschichten von der Zeit vermitteln.
So ein Film ist “Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe” von Philipp Hartmann. Es ist einer der essayistischen Filme, die mit ihren ungewöhnlichen Szenen, vorgeführten Experimenten, vielsagenden Dokumenten, faszinierenden Fundstücken und spannungsreichen, auf den Punkt gebrachten Kommentaren das Publikum dazu anregen, sich zu beteiligen, eigene Erlebnisse damit zu verbinden, selbst weiterzusinnen. Dieser Film macht es auf witzige Art möglicherweise leichter, der Gewalt und der Fremdheit der Zeit wie ebenso ihren Inspirationen zu begegnen.
Vorschau für “Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe” von Philipp Hartmann auf Vimeo. Der Autor und Regisseur ist seit 8. Oktober 2014 mit seinem Film auf Kino-Tour.
Das haben ältere Filme auf andere Weise versucht.
Mit “Echtzeit” haben es Hellmuth Costard und Jürgen Ebert 1983 unternommen, die deutlich werdenden weltweiten Veränderungen zur digitalen Virtualität zu erfassen. Sie betrachteten Arbeitsverhältnisse, militärische Planungen, Landschaften und Menschen darin. Costard sagte zum Vorgehen (dem das von Hartmann ähnlich ist): “Ich denke, man arbeitet genauer, wenn man sich nicht auf ein Drehbuch verlassen kann oder muss oder an ein Drehbuch gebunden ist, sondern wenn man nichts anderes hat als die Logik des Augenblicks.” Der entscheidende Moment, der Augenblick, der es wert ist, die volle Gegenwart - dahin geht die Sehnsucht. Schwierige, aber erfüllte Zeit.

Aus “Echtzeit” von Hellmuth Costard und Jürgen Ebert
Clemens Steiger hat in seinem Film “Von Zeit zu Zeit” (1988) mit zeitlichen Erfahrungen und Erwartungen gespielt. Geschichten verwandeln sich. Eine Kamera nimmt eine Uhr auf, später im Studio zeigen die Bilder statt der Zeit der Aufnahme eine andere. Im Film geschehen gefilmte Fiktionen auf einmal in seiner Wirklichkeit. Sehen, was sich verwirklichen lässt …

Aus “Von Zeit zu Zeit” von Clemens Steiger
Einverstanden sein mit der Zeit - das gibt es manchmal, zeitweise, wenn sich Menschen begegnen, wenn ich mich meditativ besinne, oder an besonderen Orten, an denen die Atmosphäre einer eigenen Zeit wirkt: Plätze, Stellen, die vielleicht sonst niemand beachtet, wo aber diejenigen, die sie wahrnehmen, etwas Bleibendes auf ihren Weg mitbekommen. Wim Wenders bringt mit seinen Filmen solche Orte nahe. Sein Film “Im Lauf der Zeit” (1976) lässt an einer langen Reise durch das abseitige Deutschland teilnehmen, die heute durch die Erinnerung verläuft. “Es muss alles anders werden”, hat einer auf einen Zettel geschrieben.
Schon viel länger als der Film setzt sich die Literatur mit der Zeit auseinander - “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” (”À la recherche du temps perdu”) fand sich dann Marcel Proust … Die Wortsprache ist ebenfalls ein lineares Medium und Kommunikationsmittel, sie kennt Zeitraffer und Zeitdehnung, aber beim Lesen gilt ein eigenes Tempo, und es kann zurückgeblättert werden. Im Lied wird gefragt, ob die Zeit hörbar werden kann: “Hörst du es nicht, wie die Zeit vergeht” (”Heast as nit, wia die Zeit vergeht”), singt Hubert von Goisern, und Hochsensible können angeblich das Gras wachsen hören. Dagegen können statische Bilder wie magische Orte sein; die weichen Uhren in Salvador Dalís Gemälde “Die Beständigkeit der Erinnerung” (”La Persistencia de la memoria”) lassen sich auffassen als Widerstand gegen harte Zeiten.
Auf Zifferblättern (und anderen Zeitanzeigen, wenn sie kein Datum angeben) fängt die Zeit immer wieder neu an.
> “Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe”, Film, Buch und Regie: Philipp Hartmann, 2013, 80 Min.
> Zeit statt Zeug
Matthias Kunstmann / maximil
[Dazu:
Rhythmusstörung
über die Zeitumstellung]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
9. September 2014
Sagt jemand, die Steine sind unbeweglich? Die grossen und kleinen Steine sehen aus, als ob sie in sich ruhten. Wie wenn sie sich nicht veränderten, über Jahrtausende nicht, nie: alt und jung zugleich. Wir leben mit den Steinen, den scheinbar ewigen, sie sind uns nahe. “Diese Sache liegt mir wie ein Stein im Magen”, so lautet eine Redensart bei einem Problem, das zu lösen schwerfällt. Und dann, als es erledigt ist: “Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.” Also hat er sich doch bewegt, jedenfalls in Richtung der Schwerkraft.

Meteoritenfall bei Ensisheim im Elsass am 7. November 1492, dargestellt von Diebold Schilling in der Luzerner Bilderchronik 1513
Steinschlag ist eine Bedrohung an Felshängen. Manchmal fallen Steine vom Himmel auf die Erde, Meteoriten. Diese unsere Erde, die vor allem aus Gestein besteht, dem festen Boden, den wir unter den Füssen brauchen.

Steine in Norwegen - dort heisst es, dass Wandernde den Pyramiden einen Stein hinzufügen sollten, um die Trolle (Geister) zu beruhigen. Foto: Ricklef Dmoch / pixelio
Sie können sich fortbewegen, indem sie sich tragen lassen. Bäche und Flüsse bringen sie ins Rollen (”Rolling Stones” …), schleifen sie dabei zu Kieseln und zu Sand. Das Eis von Gletschern transportiert Steintrümmer Kilometer weit. Bauern, die in bergigen Gegenden pflügen und eggen, verlagern damit die Steine in den Äckern, sie klauben grössere heraus (”Lesesteine” …) und schichten sie an den Rändern der Felder auf.

Felder und Mauern in Apulien (Italien) - Foto: Dieter Schütz / pixelio
Es wird gesagt, dass die Steine in frostigen Wintern aus dem Boden wachsen; das ist der wissenschaftlich noch kaum verstandene Vorgang des “Auffrierens”. Häuser, wenigstens die Wände, sind aus solchen Natursteinen gebaut. Gerade und einfach zu mauernde Blöcke aus dem Steinbruch zu sägen, ist schwieriger. Eher werden künstliche Steine gefertigt, traditionell besonders in steinarmen Ebenen; aus dort als Lehm vorhandenen Mineralen werden Ziegel geformt, getrocknet und gebrannt. Eine Mischung vorbereiteter mineralischer Substanzen, darunter gemahlener Steine, mit Wasser ergibt den modernen Universalbaustoff Beton.

Borie bei Bonnieux in der Provence - Foto: Dominique Repérant / Wikipedia, CC BY 2.5
Natürliche Steine sind für das Bauen, Pflastern und Dekorieren aufgrund ihrer Härte, Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Bearbeitbarkeit geschätzt - und wegen ihres Aussehens, bei dem sich von Optik oder von Schönheit sprechen lässt. Granit, Sandstein, Schiefer, Basalt, Marmor sind deshalb von ihren Fundorten aus auf immer längeren Strecken unterwegs, inzwischen rund um die Erde. Für monumentale Bauten wie den Kölner Dom fuhren schon vor Hunderten Jahren Schilfsandsteine aus den Steinbrüchen bei Heilbronn auf Schiffen den Neckar und den Rhein hinunter, obwohl auch in der Nähe Material lag. Die “Bremer Steine” für Bauten und Skulpturen in der Hansestadt kamen aus dem entfernten Weserbergland und wurden über die Nordsee an weitere Zielorte verfrachtet. Für die europäischen Bauplätze beschafft der Handel seither Steine in rauen Mengen auch aus Indien, China, Südafrika und Brasilien. Nicht unbedingt wegen der Qualität, vielmehr weil hierzuland der Landschaftsschutz mehr gilt und den Abbau beschränkt, und vor allem wegen günstigerer Preise. Die errechnen sich aus geringen Lohnkosten in den Ursprungsländern. Über deren Verhältnisse wird bei uns nicht viel bekannt, aber wir können wissen, dass dort auch Kinder unter Lebensgefahr in den Steinbrüchen hämmern, schleppen und Staub einatmen müssen, statt dass sie in die Schule gehen könnten.
“Durch sein attraktives Farbenspiel beflügelt Nevada Colored die Phantasie!”, so bietet eine deutsche Baustofffirma Sandsteinplatten an, die entgegen ihrem Namen nicht aus den USA, sondern aus Indien kommen, ebenso wie eine andere Sorte, die abwechselnd unter den Bezeichnungen “Sahara” und “Toskana” auf dem Markt ist. Phantastische Reisen der Steine …

Steine faszinieren durch ihre eigenartige Form, Oberfläche, Farbigkeit, Struktur. In ihnen lassen sich Bilder sehen. Manche Steine klingen, wenn an ihnen geklopft wird. Aus dem Feuerstein springen Funken. Besondere werden als Schmuckstücke getragen. Steine sind auch Stoff für die Kunst der Skulptur, die aus ihnen eine Gestalt befreit. Im griechischen Mythos haben Deukalion und Pyrrha nach einer katastrophalen Flut Steine auf den feuchten Boden geworfen und daraus entstanden Menschen, aus seinen Steinen Männer, aus ihren Frauen …
“Ich griff nach dem Steine, den ich neben mir zur Wegebesserung mit frischem schwarzglänzendem Bruche zerschlagen fand, und erkannte ihn als einen gültigen Zeugen grösserer Weltbegebenheiten, als die ich erlebt hatte.”
Achim von Arnim
maximil
> Die Kinderhilfsorganisation terre des hommes zu Natursteinen
> Xertifix: ethisches Siegel für Steine
> Fair Stone: Sozial- und Umweltstandard
[dazu:
Nah dran und mitten drin - Leben in der Region
Kunst begegnet Natur]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik