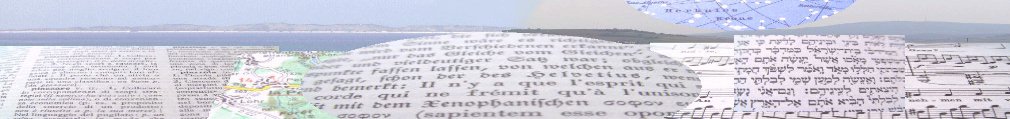21. Dezember 2017
Nie war Deutschland so reich wie jetzt. Schauen wir uns an, was frühere Generationen sich nicht vorstellen konnten, auch wenn sie sich in ihren Träumen viel Geld, eine Villa, ein Auto und Reisen in die Ferne wünschten. In anderen Weltgegenden erscheint es Menschen wie ein Paradies.
Schon die Lebensmittelmärkte voller Spezialitäten, Delikatessen von weit her, Appetit anregend verpackten Fertiggerichten … Der erste europäische Supermarkt eröffnete 1957 in Köln. Inwischen werden rund ein Drittel der erzeugten Lebensmittel früher oder später zum Abfall geworfen.
Die glitzernden Einkaufsgalerien, in denen sich Gastronomiebetriebe und Modegeschäfte auf mehreren Etagen aneinanderreihen, und das Geld dafür kommt von einem Kärtchen oder aus der Wand (dem Automaten) … Von Parkhäusern aus sind sie wettergeschützt erreichbar. Damit zum Konsum motiviert wird, begegnet Werbung, mit Hochglanz gedruckt oder audiovisuell inszeniert, an vielen Stellen, draussen, zu Haus, in den Medien.
Die grosszügigen Wohnungen sind warm, hell, haben komfortable Bäder und sind mit Arbeit sparenden Geräten ausgestattet, Geschirrspül- und Waschmaschinen sowie Trocknern und auch schon Robotern, bieten leichten Zugriff auf Vorräte in Tiefkühlschränken und unterhalten mit breiten Bildschirmen und aufwendigen Musikanlagen. Mobiliar und Accessoires werden öfter gemäss dem veränderten Zeitgeschmack ersetzt. Für mehr und grössere Haustiere ist auch Platz.
Mit Spielzeug sind die Kinder eingedeckt. Die bunten Dinge, die batteriebetrieben einiges von selbst können, lassen nicht mehr viel Raum für Fantasie.
Die grossen Autos mit elektronischen Fahr- und Navigationshilfen verkehren auf Strassen, deren Netz weiter verdichtet wird. Wer ein kleineres Fahrzeug nutzt, sieht einkommensschwach aus.
Die schnellen und bequemen Bahnen und Busse erleichtern es, mobil zu sein, auch spontan. Entfernte Orte sind nahe Ziele.
Reisen auf die andere Seite der Erde sind nichts Ungewöhnliches, wie auch nicht der Kurzurlaub an einem Palmenstrand oder eine Kreuzfahrt.
Verschiedenste Sportarten werden mit jeweils spezieller Ausrüstung praktiziert. Die meisten Aktiven schwitzen freiwillig, unbezahlt, zum Vergnügen.
Für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Schönheit wird viel getan. Ob sinnvoll oder nicht, zahllose Drogerien stellen eine Fülle von Pflege-, Reinigungs- und Kosmetikprodukten bereit, die sich oft weniger in der Substanz und mehr in der Verpackung, Anmutung und Verheissung unterscheiden.
Die Unterhaltung ist eine der bedeutendsten Industrien. Spektakuläre Veranstaltungen werden geboten, Sportereignisse oder Konzerte beeindrucken besonders in riesigen Arenen das Publikum, Kinos, Theater, unzählige Radio- und Fernsehsender sowie Internetplattformen machen Freizeitprogramme.
Informationen über die Welt sind mit Internet und mobiler Kommunikation überall in einer Menge zu bekommen, die eher verwirrt, als dass sie zu bewältigen ist: Was ist wichtig? Was fangen wir damit an?
Die Kunst - auch sie floriert, stellt sich in Galerien aus, wo einmal kleine Läden waren, und in neuen Museen, sie steht auf vielen öffentlichen Plätzen, und Kunstwerke sind Geldanlagen mit steigenden Renditen geworden. Häufig ist das Gestalten ein kulturelles Gewerbe, das zur humanen Bildung kaum etwas beiträgt.
Geht es uns gut? In diesem allgemeinen Wohlstand sollten wir wenig zu klagen haben. Dennoch sind die unerfreulichen Wirkungen zu sehen.
Der Reichtum verschwendet Rohstoffe und Energie und macht teils Schadstoffe daraus, er verbraucht Naturschätze und beeinträchtigt die Umweltqualität.
Die Gerechtigkeit fehlt. Zwar lässt unser Staat auch die Ärmsten nicht hungern, garantiert eine Wohnung und sorgt für Medizin. Aber keineswegs sind die Unterschiede im Einkommen einfach durch mehr oder weniger Leistungswillen bedingt. Eine Gesellschaft, die ungleiche Chancen nicht ausgleicht, die nicht eine gerechte Teilhabe ermöglicht, beachtet ein entscheidendes Gut nicht ausreichend und verletzt die Menschenwürde.
Unser Luxus ist auch ungerecht gegenüber armen Ländern. Ungünstige Voraussetzungen, besonders historische Abhängigkeiten benachteiligen Regionen. Deutsche Unternehmen profitieren nach wie vor und teilweise mehr denn je von Arbeitskräften und Ressourcen solcher Länder. Wenn Menschen von dort Anteil an unserem Reichtum wollen, dann ist das Anlass, die Strukturen der Weltwirtschaft zu ändern. Und wir können von unserem Überfluss noch weit mehr abgeben, ohne selbst Mangel zu leiden.
Mangel im Überfluss gibt es allerdings. Denn unbeherrschter Konsum verhindert, dass Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln. Sie finden das nicht, wofür viele materielle Dinge nur ein unzureichender Ersatz sind, nämlich eigene und soziale Werte.
Der materielle Fortschritt fordert zugleich Verzicht auf einiges, was individuell und gesellschaftlich wertvoll ist. So gibt es kaum noch erholsame Ruhe, weil Arbeitsverhältnisse unsicher sind und der berufliche Druck zunimmt. Wenn Geschäfte nur noch über Rechner oder Automaten abgewickelt werden können, ist das vielleicht einfacher, aber es kommt kein menschliches Gespräch mehr zustande.
Folglich wirkt sich Reichtum zerstörend auf Menschen, ihre Gesellschaft und ihre Umwelt aus. Am krassesten ist dies im Militär, für das gerade Deutschland Unsummen zum Zweck der Vernichtung ausgibt, begründet auch damit, dass der nationale Wohlstand geschützt werden soll. Das Geld wäre stattdessen in Friedensdiensten gut angelegt.
Wir können für vieles dankbar sein. Wir sollten kritisch bewerten. Womit habe ich genug? Wenn ich immer mehr will, bin ich nie zufrieden.
Darauf kommt es an: vorhandene Güter achten, menschliche Werte schätzen, Gemeinschaft mitgestalten. Die Möglichkeiten des Geniessens sind da.
Matthias Kunstmann / maximil

[Dazu:
Geld fehlt Wert
Wirtschaft ist nicht alles
Fortschritt?
Schneller - wohin und warum?
Fällige Kritik des Wachstumsdenkens]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
21. September 2017
Wo gebaut wird, wiederholen sich die Rechtecke. Sie sind die Form, die fast überall im neueren menschlichen Siedlungsbereich ins Auge fällt, als könnte es nicht anders sein. Gebäude zum Wohnen oder Arbeiten oder auch nur zum Lagern von Waren sind quaderförmig und die Fenster in entsprechendem Raster. Von solchem Gleichen wird weltweit immer mehr in die Landschaft gestellt, und innen ist ebenso der rechte Winkel das dominierende Prinzip der Gestaltung, auch beim Mobiliar. Das wirkt eintönig, langweilig, deprimierend. Wie kommt es dazu?

Moderne Architektur spiegelt alte in Hamburg - Foto: Sami99tr,
Lizenz CC BY-SA 3.0
Ein Grund ist, dass sich mit rechten Winkeln einfach planen und billig produzieren lässt. Das Gestalten, soweit davon die Rede sein kann, darf einfallslos vor sich gehen, das Ausführen erfordert gleichfalls keine besonderen Kompetenzen. Behauptet wird, die Rechtwinklichkeit sei modern. Eine andere Formgebung wird vor allem in der Architektur von den Modernen als rückwärtsgewandt oder irrational abgewertet. Es ist festzustellen, dass der rechte Winkel ein Ergebnis der Abstraktion, des vereinfachenden Denkens ist. Sobald er ein Prinzip des Lebens werden soll und in einer Vielzahl von Gegenständen materialisiert wird, ist er ideologisch und im Zwang zur Ausrichtung der Welt sogar faschistisch. Er ist ein Zeichen für die Entfremdung des Menschen von der Natur - und damit auch von dessen natürlichen Bedürfnissen.
In der Natur sind gerade Linien und rechte Winkel äusserst seltene Formen unter einer Vielfalt anderer, erscheinen etwa an Kristallen von Salz und sonst wenigen Mineralien. Aber die Natur ist nicht starr wie manche Denkprinzipien, Normen und Verhaltensmuster. Wasser löst die Salzkristalle auf. Eine Tatsache ist, dass die Schwerkraft rechtwinklig zur Erdoberfläche wirkt; Bäume wachsen entgegen dieser Kraft und der Mensch hat mit ihr den aufrechten Gang gelernt. Sichtbar und zu erfahren ist aber meistens ganz anderes: Der Erdboden ist uneben, theoretisch waagrechte Wasserflächen haben Wellen und sind wie der Globus gekrümmt. Bäume wachsen zur Sonne und mit dem Wind, Blätter und Samen fallen nicht senkrecht, sondern können weit schweben. Menschen gehen gebeugt oder sitzen … Und Vögel fliegen die verschiedensten geschwungenen Linien.
Architektur, Handwerk und Kunst haben in ihrer Geschichte den rechten Winkel nur an bestimmten Stellen gebraucht. Für Häuser ist es sinnvoll, dass die Böden eben liegen und die Wände senkrecht stehen, im Übrigen geht beinahe alles. Bei Textilien verlaufen die Fäden von Kette und Schuss regelmässig quer zueinander, doch dann wird diese zweidimensionale Struktur in räumlichen Bögen und Verknüpfungen zu Kleidung geformt. Buchseiten sind meistens rechteckig, kaum dagegen ist es die Schrift.

Neue Staatsgalerie Stuttgart - Foto: Jaimrsilva, Lizenz CC BY-SA 4.0
Für das menschliche Leben sind die Ecken oft unbequem und innen schlecht zu nutzen, aussen kann sich jemand daran stossen, an Gegenständen werden sie abgewetzt und an Wegkreuzungen im Grünen abgekürzt, durch Flachdächer von Quaderbauten tropft der Regen. Praktisch und sinnlich wahrgenommen, ist die Rechtwinkligkeit so wenig funktional wie elegant. Sie wird deshalb auch nicht auf Fahrzeuge aller Art angewendet, denn da muss der Widerstand von Luft oder Wasser berücksichtigt werden und zudem sollen sie dynamisch aussehen. Und auch Kulturbauten wie Theater, Konzerthallen, Museen zeigen architektonische Freiheit.
Es gibt Gründe für das Übliche - und es gibt fast immer mindestens einen guten Grund, etwas anders zu machen.
Matthias Kunstmann / maximil
[Dazu:
Leben mit der Natur]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur
31. Juli 2017
Viele wissen es nicht - Holzkohle für Grills kommt oft aus tropischen Wäldern. Zum Beispiel im südamerikanischen Paraguay fällen Unternehmen dafür alte Bäume, um anschliessend riesige Viehweiden oder Sojafelder für die industrielle Landwirtschaft anzulegen. Lebensräume für Tiere und Pflanzen gehen verloren, und auch für die Menschen, die dort seit langer Zeit mit der Natur wirtschaften. Der Fall zeigt, dass verantwortliches Handeln Interesse und Informationen braucht.

Wald im Gran Chaco in Paraguay - dort wird grossflächig für die industrielle Landwirtschaft gerodet und das Holz zu Kohle gemacht. Foto: Ilosuna, Lizenz CC-BY-1.0
Geselligkeit um die Grillglut ist wertvoller, wenn sie auf ökologische Zusammenhänge achtet. Holz ist zwar immerhin ein erneuerbarer Brennstoff. Ein Gasgrill müsste entsprechend von Bioenergie gespeist sein, ein Elektrogrill von Ökostrom. Kohle ist geeignet, wenn sie aus Holz hergestellt ist, das in Mitteleuropa wächst. Hier ist am besten nachweisbar, dass der Wald gepflegt wird und die Produktion kaum Schadstoffe hinterlässt. Es gibt mindestens einen deutschen Anbieter von Kohle aus heimischen Buchen.
Einen längeren Transportweg hat Brennstoff aus schnell nachwachsendem Bambus. Besonders nachhaltig ist es, pflanzliche Reste aus der Lebensmittelproduktion zu nutzen. Dies können Olivenkerne aus Ölpressen sein. Damit haben sich Betriebe in Griechenland einen Verdienst geschaffen, sodass angesichts der Wirtschaftslage dort der Kauf solcher Grillkohle auch einen sozialen Vorteil bedeutet. Ähnlich es mit Kohle aus Kokosnussschalen, die in fairem Handel hergestellt und geliefert wird.
Brennmaterialien dieser Art können mehr kosten. Zum Teil geben sie dafür länger und intensiver Energie ab. Im Übrigen sollte eine Gesellschaft, die genug Leckeres auf den Grill zu legen hat, nicht an den sozialen und ökologischen Werten sparen.
maximil
> Rettet den Regenwald
> Faire Kohle

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
31. Mai 2017
Ein Fest allein feiern? Das geht auch. Manche müssen es, weil sie einsam sind. Manche mögen es, weil sie dann mal zu sich kommen. Die meisten feiern aber lieber mit anderen. Sie können sich dabei mit ihrer Sonnenseite zeigen, entspannt miteinander sprechen, besonders witzig sein und geniessen.
Zwischen den Festen ist das nicht so leicht möglich. In der täglichen Arbeit kämpfen alle oft allein, in Konkurrenz zueinander, müssen Höchstleistungen liefern, wenn sie dazugehören möchten und ein ausreichendes Einkommen beziehen wollen. So verlangt es das Wirtschaftssystem: gegeneinander statt miteinander. Die Folge ist, dass die einen ihre teils zufälligen Vorteile bedenkenlos ausnützen und auch mit wenig Arbeit in unsäglichem Luxus leben, während die anderen hart arbeiten und doch durch ungünstigere Voraussetzungen in bescheidenen Verhältnissen bleiben. Da stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit.
Die herrschende Denkweise setzt auf den menschlichen Egoismus und verspricht, dass damit schon für alle gesorgt ist. Das stimmt nicht. Dabei leiden viele bis in die höheren Gehaltsstufen unter dem Druck, und auch Reiche fühlen sich nicht vor Armut sicher. Schlimm ist überdies, wie sich das System im grösseren Ganzen auswirkt: Der Staat, die Länder und Gemeinden leisten nicht genug für die Allgemeinheit, und ihre Aufgaben werden noch eingeschränkt. Staatliche Einrichtungen werden privatisiert, wo sich Geschäfte machen lassen, und sind damit schnell überteuert sowie unzuverlässig. Die staatliche Verwaltung wird abgebaut. Die Justiz ist unterbesetzt. Der öffentliche Dienst mit seinen Fachkräften für Soziales, Infrastruktur, Bildung wird zu wenig unterstützt und unter Wert bezahlt. Dies bedeutet, dass drängende Probleme der Gesellschaft nicht gelöst werden. Es gibt viele Anlässe, von Politikversagen zu reden.

Plakat der Gewerkschaft ver.di
Damit sich dies ändert, braucht es mehr Sinn für die gemeinsamen Interessen. Zunächst ist das Gespräch wichtig: Was wollen wir? Warum? Wie erreichen wir unsere Ziele am besten? Wir machen die Politik! Was Einzelne nicht zustande bringen können, ist in Zusammenarbeit zu schaffen. Einsatz lohnt sich in der Nachbarschaft, an den Arbeitsplätzen, in den Kitas und Schulen, in Vereinen, im Staat und darüber hinaus. Gemeinsamkeit nützt allen.
Vernunft muss dabei sein. Zu ihr gehören Information, Wissen, auch politische Bildung. Die staatlichen Institutionen müssen bei ihren Aktivitäten gewährleisten, dass sie immer transparent sind. Wie sich oft zeigt, könnten sie ihre Aufgaben für das Gemeinwohl besser erfüllen. Den Bürgern und Bürgerinnen muss es möglich sein, über Lösungen mitzubestimmen, durch erweiterte demokratische Entscheidungsverfahren.
Alle sollten auf die “Gemeingüter” achten, das gemeinsame Eigentum: Luft, Wasser - jeweils sauber -, die öffentlichen Plätze und Einrichtungen, die Verkehrswege, die Natur und die Kultur. Die Wirtschaft liesse sich auf den allgemeinen Nutzen ausrichten, sogar auf das gemeinsame Glück. Beispiele für Gemeinsamkeit, die den gleichberechtigten Beteiligten optimal zugute kommt, sind Genossenschaften, von denen sich viele längst bewährt haben, und manche Gemeinschaften, die neue Formen des Zusammenlebens erproben. Miteinander gibt es nicht nur bei Festen gute Gründe für Freude.
> Bundeszentrale für politische Bildung
> Gemeinwohl-Ökonomie (Förderverein)
> Gemeingut in BürgerInnenhand
> Forum Gemeinschaftliches Wohnen
> Ökodorfgemeinschaften
> Gemeinschaft Tempelhof
Matthias Kunstmann / maximil
[Dazu:
Neue Nachbarschaft
Wasser ist ein Menschenrecht]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
29. März 2017
Leben im Augenblick, ohne Gedanken an das Vergangene oder das, was kommt - das ist intensiv, faszinierend, berauschend. Diese Augenblicke sind allerdings in unserer Zeit sehr kurz geworden, einer löst rasant den anderen ab, entscheidend ist mehr das Tempo als das Ereignis. Was vorbei ist, interessiert nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn … Alles vergessen und nichts verstanden?
So geht es auch mit Nachrichten, die ankommen, persönlichen oder politischen: Sie treffen schneller ein als zuvor, in steigender Zahl, und sind so kurz wie möglich, damit die empfangende Person schnell genug auf die nächste Kurznachricht aufmerksam wird. Führend ist dabei der Kommunikationsdienst Twitter, der inzwischen auch vom vermutlich mächtigsten Mann der Erde genutzt wird, und ein grosser Teil der Medien macht es nach. Wie bei Produkten und Unterhaltungsangeboten zählt das Neue, nicht der Wert.
Die Folgen sind zunehmend unbedachte emotionale Reaktionen. Als Reflex auf einen Reiz äußert sich zuerst ein Gefühl, vielleicht verbunden mit einer instinktiven Aktion. Dabei bleibt es, wenn die Zeit oder der Wille zum Nachdenken nicht reicht. Der Mensch lernt nichts. Bewusste Diskussionen, um mit anderen Lösungen zu finden, fallen aus. Die Politik als Angelegenheit der Gemeinschaft versagt.
Verstehen, erfassen, was ein Ereignis bedeutet, womit es zusammenhängt und was daraus werden soll, denken - das braucht Zeit. Und einiges mehr: etwas Ruhe; dann Konzentration; und es braucht die Erinnerung an das, was vorher war. Der Aufwand bringt Wissen, befähigt dazu, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und Probleme zu lösen. Vieles wird klar, und Erlebnisse, die sonst flüchtig wären, können dauerhaft und wertvoll werden.

Tanz um einen Freiheitsbaum in Deutschland nach der Französischen Revolution, um 1792/95 (unbekannter Maler)
Aus der persönlichen Vergangenheit entsteht die Identität. Sie ermöglicht ein souveränes Selbstbewusstsein. Wenn in der Gegenwart etwas nicht stimmt, kann die Ursache in der Lebensgeschichte liegen und vergessen sein. Dann empfiehlt es sich, nachzuforschen: Gab es eine verletzende Erfahrung? Wer oder was hat Einstellungen, den Charakter und Verhaltensweisen beeinflusst? Wie kam es zu Mängeln oder Irrtümern? Je besser wir unsere Geschichte kennen, umso freier können wir jetzt entscheiden.
Entsprechendes gilt für die weitere Geschichte einer Gemeinschaft, einer Region, eines Landes, einer Kultur, der Welt. Was wir miterlebt haben, sollten wir bei Bedarf vergegenwärtigen. Das Gedächtnis sagt uns etwas, aber diesmal wollen wir es genauer wissen und erkundigen uns nach Einzelheiten, Gründen, besonders seither gefundenen Erkenntnissen. Was scheinbar ausserhalb der eigenen Erfahrung geschehen ist, hat oft doch mit uns zu tun - umso wichtiger ist, sich fallweise damit zu beschäftigen. So können wir uns in der Welt orientieren. Zudem ist geschichtliches Wissen wie das Foto eines Platzes, das sich in die dritte Dimension öffnet, sodass ich hineingehen kann.
Wer die Enge seiner Heimat ermessen will, reise. Wer die Enge seiner Zeit ermessen will, studiere Geschichte.
Kurt Tucholsky
Bevor die Medien etwas angeblich Neues verbreiten, sollten sie recherchieren, wie es sich aus Altem ableitet, was dahintersteckt und wie es mit anderem zusammenhängt. In den Archiven ist viel zu finden, und zum Nachfragen müsste auch Zeit sein. Zum Beispiel stärken Meldungen in Deutschland zu oft die Polemik gegen die Politik Russlands, und dabei wird unterschlagen, dass Deutsche im Zweiten Weltkrieg unzählige russische Menschen getötet und das Land verwüstet haben - die Opfer und ihre Nachkommen erinnern sich noch.
Wer eine Ahnung von den historischen Wurzeln der Zivilisation hat, kann sich besonders darüber wundern, dass die USA als eine der jüngsten Nationen den Irak bombardiert und in anhaltendes Chaos gestürzt haben, das Land der ältesten Kulturen, die für Europa und Amerika bedeutend waren. Ähnliches lässt sich im Umgang Europas mit Griechenland feststellen, dem wir einen grossen Teil unserer Kultur zu verdanken haben.
Das ist nicht mehr vielen bekannt. Dieses Wissen gehört zur humanistischen Schulbildung, die aufgrund der Herrschaft der Ökonomie von den Naturwissenschaften, der Informatik und Wirtschaftsausbildungen verdrängt wird. Mit ihr ist das Fach Geschichte auf dem Rückzug. Allerdings haben die Schulen Geschichte zu oft als langweiligen Stoff dargeboten. Auf den Bezug zum Leben kommt es an. Viele Museen lassen Geschichte erleben und sind mit bunten Inszenierungen oft das andere Extrem gegenüber dem dozierenden Unterricht. Die Schulen sollten die Museen mit ihren Mitmachwerkstätten mehr nutzen und das Erlebte erklären.
Geschichtliche Erkenntnisse werden ausserdem auf verschiedene Weise anschaulich vermittelt. Gebäude und Geräte sind Dokumente, private Erbstücke zeigen die Herkunft der Familie, alte Menschen erzählen als Zeitzeugen, Gemälde, Romane und Filme berichten von anderen Zeiten und Gegenden. Überall lassen sich Spuren, Zeichen, Geschichten entdecken, wahrnehmen und auch geniessen.
Daraus wird die eigene Geschichte, die weitergeht, und ein reicheres Leben im Hier und Jetzt.
Matthias Kunstmann / maximil
[Dazu:
Schneller - wohin und warum?
Fortschritt?
Stehen lernen]

Themen: Allgemein · Kultur · Politik
20. Dezember 2016
Gesund sein, vor Leben sprühen, aus dem Vollen schöpfen, sich wohl befinden, in sich ruhen, zufrieden sein … Ich wünsche, es wäre immer so. Für mich und meine Mitmenschen. Aber so rundum gesund sein können wir nur mehr oder weniger. Immer wieder stört etwas. Ich erreiche nicht, was ich will. Es gibt Ärger mit anderen. Die Arbeit stresst. Ich bin vor dem Abend müde. Etwas schmerzt mich körperlich oder seelisch. Oder jemand ist krank, verletzt, behindert.
Das ist das Gegebene. Wir versuchen, damit möglichst angenehm zu leben. Um mich gesund zu fühlen, achte ich auf das Folgende.
ATMEN: Luft brauchen wir immer. Doch öfters gelingt es nicht, ausreichend zu atmen. Es ist mehr als Luftholen: Tiefes Durchatmen belebt, entspannt und beruhigt zugleich. Natürlich ist es am besten in frischer Luft. Wenigstens einmal am Tag sich anstrengen bis zum kräftigen Atmen, das weitet die Lunge, sodass sie auch sonst mehr Luft aufnehmen kann. Beim Durchatmen können wir ausserdem die Haltung wiedergewinnen, die zum richtigen Handeln befähigt. Sogar die Inspiration kommt nach ursprünglichem Verständnis im Atem.
Solange ich atme, hoffe ich.
(Marcus Tullius Cicero)
WASSER: Das Leben kommt aus dem Wasser. Die Körperfunktionen vom Verdauen bis zum Denken sind auf genügend Flüssigkeit angewiesen. Trinken hilft gegen viele Beschwerden. Leitungswasser ist meistens das frischeste Getränk. Äusserlich fördert Wasser in warmen und kalten Duschen oder Bädern die Durchblutung und das Wohlbefinden.
Alles fliesst.
(Heraklit zugeschrieben)
ESSEN: Sich nach Gefühl ernähren wäre schon recht, doch einige Gedanken sorgen für eine gesündere Auswahl der Lebensmittel. Denn was üblich, verlockend oder bequem ist, kann sich ungünstig auswirken. Qualität ist wichtig, und sie sollte kritisch beurteilt sein. Den Vorzug verdienen ökologische, regionale und fair gehandelte Erzeugnisse, sie sind gleichzeitig für die menschliche Umwelt und Kultur gesund. Die Menge der Nährstoffe sollte ebenfalls stimmen: An Salat und Obst hat der Organismus täglich Bedarf, Proteine wie in Fleisch, Eiern und Milchprodukten werden hierzuland zu viel verzehrt, und oft verführt der Wohlstand dazu, mehr zu essen, als bekömmlich ist. Vielfalt ist zu empfehlen, und besonders Esskultur: Schön zubereitete Speisen, die wir an einem Platz mit erfreulicher Atmosphäre, ruhig und locker geniessen, achtsam - das tut auch der Seele gut.
BEWEGEN: In der mobilen Gesellschaft bewegen sich die Menschen meist zu wenig selbst. Die gewohnte Arbeit im Sitzen vor dem Bildschirm verschärft die Situation. Öfter aufstehen und ein Stück gehen, noch öfter den Kopf wenden und den Blick woandershin richten, sich strecken … Allgemein sind körperliche Übungen morgens und abends hilfreich. Wohltuend ist es zwischendurch schon, die Glieder zu schütteln und das Rückgrat aus Beugung und Anspannung zu lösen. Gehen kann übrigens zugleich das Denken in Bewegung bringen.
WAHRNEHMEN: Über sich selbst mehr wissen und erfahren, über den Organismus, biologisch, medizinisch, psychologisch - das erleichtert es, sich bewusst so zu verhalten, dass es guttut. Und weil Lebewesen sich entwickeln wollen, sollten sie mit allen Sinnen aufnahmebereit sein für das Vorhandene und darüber hinaus für das, was möglich ist. Sie können im Inneren ihre Bedürfnisse, Kräfte und Fähigkeiten wahrnehmen. Und die äussere Welt bietet ihnen eine Fülle von Geschenken und Möglichkeiten, die sich aufmerksam sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten, empfinden, erkennen lassen.
BESINNEN: Die Zeit und die Umstände drängen oft und machen besinnungslos. Wir sollten so souverän sein, dass wir uns angemessene Pausen gönnen, um uns zu besinnen. Denn es geht immer wieder darum, sich zu orientieren und herauszufinden, was richtig und gut ist.
KOMMUNIZIEREN: Durch Beziehungen wird das Leben reich. Sie können aber auch belastend sein, in Krisen, Konflikte, Konfrontation geraten und schaden. Es kommt darauf an, sich gegenseitig zu verstehen und zu verständigen, sich empathisch in die andere oder den anderen einzufühlen, um das Gemeinsame zu ermitteln und zu Konsens und Kooperation zu gelangen. Kommunizieren kann heilen, über die Beteiligten einer Beziehung hinaus. Gemeinsam kann Besseres entstehen als allein.
Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
(Montesquieu)
AUFGABEN: Das Beste geben - das ist mein Vorsatz für alles, was ich tue; zuerst gegenüber den Mitmenschen, ebenso im Beruf, in freiwilliger Arbeit, in der persönlichen Bildung. In den gewählten Aufgaben soll Sinn sein, dann können sie glücklich machen. Überfordern soll sich niemand, das brächte nicht die gewünschten Ergebnisse.
Jeder ist berufen, etwas in der Welt zur Vollendung zu bringen.
(Martin Buber)
RHYTHMUS: Alles hat seine Zeit. Für Vorhaben gibt es den passenden Moment und die geeignete Dauer. Dann ist wieder Abwechslung dran, damit das Gleichgewicht erhalten bleibt und das Leben tänzerisch, beschwingt und vielseitig weitergehen kann. Das Herz gibt seinen Rhythmus. Gewohnheiten und Rituale bieten Halt; wenn sie zu starr werden, sollte sich etwas ändern. Was, das lässt sich spüren - und dann erneuern.
LICHT: Physisch stärkt das Licht der Sonne im Freien, psychisch hebt es die Stimmung auch in hellen Innenräumen. Da kann eine Lichtregie ebenso mit künstlichen Quellen das Wohlbefinden und die Schaffensfreude deutlich beeinflussen. Manche mögen Glanz, andere eher Gemütlichkeit. Auch die Lichtfarbe wirkt unterschiedlich. Punktlicht steigert bei vielen Tätigkeiten die Konzentration. Aber gleichfalls kann in der Dunkelheit Erleuchtung kommen …
SCHLAFEN: Nach den Leistungen des Tages müssen wir im Schlaf gar nichts tun. Wer dies nicht von selbst geniesst, schläft vielleicht erholsamer und erquickender, wenn klar wird: Im Bett nach dem Erlöschen des Lichts können wir loslassen, müssen nichts mehr denken, brauchen nichts mehr zu sorgen - Schlaf, Zeit und Traum erledigen Staunenswertes für uns. Wärme trägt dazu bei, und es ist ratsam, Schlafenszeiten gemäss dem persönlichen Biorhythmus zu beachten. So ist wahrscheinlich, dass wir über Nacht Frische, Wachheit, Kräfte und Lebenslust gewinnen.
GELASSEN SEIN: Gerade wenn es nicht so ist wie gewünscht - durchatmen, lächeln, gelassen einfach sein … Das ist nicht einfach, doch immer wieder einen spielerischen Versuch wert. Keinesfalls ist es nötig, auf alles sofort zu reagieren. Erst einmal schauen, sich besinnen, und alles Weitere ergibt sich am besten wie im Gebet eines Einsichtigen (*) um Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind, um Mut, Dinge zu ändern, die geändert werden sollten, und um die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aufrichtiges Lächeln erzeugt übrigens tatsächlich entsprechende Gefühle. Und Humor lässt vieles leichter werden. Also: Ich kann das Leben gut sein lassen.
Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Jetzt wünsche ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass Sie möglichst gesund sind oder es werden, in diesem Jahr und im nächsten!
Claire Destinée / maximil
(* Reinhold Niebuhr, um 1942)
[Dazu:
Vor dem Bildschirm
Alle gewinnen mit Empathie
Lichtempfinden]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur
24. Oktober 2016
Vieles wird teurer. Die Zahlen des deutschen Statistischen Bundesamtes für die sogenannte Inflationsrate sehen dennoch klein aus - als hätten wir uns getäuscht und alles wäre ganz normal. Interessierte weist das Amt selbst darauf hin, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen statt dieser Durchschnittszahlen mit deutlich anderen Preissteigerungen zu rechnen haben. Haushalte, die einen grossen Teil ihres Budgets für Lebensmittel, Miete, öffentlichen Nah- und Fernverkehr oder Strom brauchen, zahlen jedes Jahr einiges über der offiziellen Rate hinzu. Gerade alltägliche, nötige, unvermeidliche Produkte und Dienstleistungen kosten immer mehr. Das trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen.
Die Statistik kann bekanntlich zu beliebigen Ergebnissen gelangen. Seit das Bundesamt die Methode der “hedonischen Preisbereinigung” anwendet, ist die Inflation geringer: Qualitätsverbesserungen von Produkten werden mit den steigenden Preisen verrechnet, sodass unter dem Strich niedrigere Kosten stehen. Verschlechterungen wie kürzere Lebensdauer oder weniger Kundendienst werden dagegen nicht berücksichtigt. Das funktioniert so seit 2002, dem Jahr, in dem der Euro eingeführt wurde.
Die politische Absicht dahinter ist, die Motivation zum Konsum aufrechtzuerhalten und, soweit es geht, zu steigern. Die Preise sollen nicht vom Kauf abschrecken. So erzielt die Wirtschaft hohe Gewinne. Deshalb sind auch die Zinsen auf Guthaben und Kredite praktisch abgeschafft: Die Leute sollen alles verfügbare Geld ausgeben, damit die Wirtschaft weiter wächst.
Inflation gehört zu diesem Konzept. Die Europäische Zentralbank definiert die Preisstabilität, für die zu sorgen ihre Aufgabe ist, mit einer statistischen Preissteigerungsrate von knapp unter 2 Prozent. Wenn die Einkommen ähnlich steigen und entsprechend Kaufkraft vorhanden ist, dient das dem viel beschworenen Wirtschaftswachstum.
Mit ihm nimmt zwar der materielle Wohlstand bei uns insgesamt weiter zu und ist längst oft Luxus zu nennen, aber diesen geniessen manche extrem, während immer grössere Bevölkerungskreise keine angemessenen Einkommenszuwächse haben und in engen finanziellen Grenzen leben. Das jedoch ist für die Regierungen weniger ein Problem als die abnehmende Nachfrage derjenigen Menschen, die inzwischen genug haben und nicht immer mehr konsumieren wollen.
Gemäss den klassischen Marktgesetzen würde weniger Nachfrage bei gleichem Angebot von Produkten zu niedrigeren Preisen führen. Dies wäre ein Grund, überflüssiges Geld nicht für den Konsum auszugeben, sondern damit immaterielle Güter zu fördern: soziale Arbeit, Bildung, Kultur, Projekte für die menschliche Gemeinschaft. Und ein Grund mehr, beim nötigen Konsum Produkte und Dienstleistungen mit ethischem Mehrwert zu bevorzugen: solche, die nachweislich ökologisch, sozial, fair sind, also nicht nur in Worten nachhaltig. Damit würde auch den schädlichen Folgen des wirtschaftlichen Wachstums entgegengewirkt.
maximil
[Dazu:
Geld fehlt Wert
Fällige Kritik des Wachstumsdenkens
Wirtschaft ist nicht alles]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
31. August 2016
Es ist Zeit für neue Gedanken. Besonders in der Politik, die Wichtiges regeln soll, was uns alle betrifft. Das funktioniert nicht mehr mit den alten Strukturen und Verfahren. Konflikte und Krisen in vielen Ländern kommen nicht aus gegensätzlichen politischen Ansichten der Menschen, sondern daher, dass die Politik ihre Aufgaben nicht erfüllt. Von Politikversagen ist die Rede. Damit nicht Mächtige, Unfähige oder Gefährliche bestimmen, unter welchen Bedingungen wir leben, muss sich Grundsätzliches ändern. Deshalb der Vorschlag, darüber nachzudenken: Brauchen wir Regierungen - oder regieren wir uns besser selbst?
Was tun Merkel und Gabriel, Hollande und Valls, Renzi und Alfano, Cameron, Obama, Putin und Medwedew, Erdoğan und Yıldırım, Szydło, Rajoy oder Juncker mitsamt ihren Ministerinnen und Ministern für die Völker? Was leisten sie, welche Schäden richten sie an? Lösen sie Probleme oder erzeugen sie welche? Ihre Köpfe sind ständig in den Medien, sie reden und über sie wird geredet, aber was genau wird durch sie für uns besser?
Wir sollen ihnen glauben, wenn sie uns sagen, dass die Probleme von aussen kommen, von Exportschwierigkeiten, von Billigkonkurrenz, von Weltmarktpreisen, vom Islamismus, von den Flüchtlingen, von der EU, von Verschwörergruppen, von Internetkriminellen, von der Mafia oder einfach von den anderen. Dabei sind sie selbst das Problem.
Die Regierungen vergrössern meistens die soziale Ungerechtigkeit. Sie verhindern humane Bildung. Sie lassen die Klimaerwärmung zu. Sie unterstützen die industrielle Landwirtschaft, die der Gesundheit, den Tieren und der Umwelt schadet. Sie reduzieren den öffentlichen Dienst und die Verwaltung, die für das Allgemeinwohl da ist. Sie beteiligen sich an der Ausbeutung armer Länder. Sie fördern die Rüstungsproduktion, heizen internationale Konflikte an und führen Krieg. Sie unterdrücken abweichende Ansichten. Sie brechen immer wieder das Recht, obwohl sie vom Rechtsstaat reden, und missachten die höchsten Gerichte. Sie halten nichts von echter Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie.
Manchmal verteilen die Regierungen auch Wohltaten. In Deutschland hat die Regierung einen Mindestlohn eingeführt, nachdem es ihn in anderen Ländern längst gab. Der US-Präsident hat mit einer Gesundheitsreform versucht, den Armen medizinisch zu helfen; dies ist nur zum Teil gelungen. In der Bilanz sehen die Regierungen schlecht aus.
Mit ihrem Handeln und Unterlassen sind die derzeitigen Regierungschefs und -chefinnen, auch wenn sie sich demokratisch nennen - Wahlen verändern bekanntlich nur sehr wenig -, immer noch den selbstherrlichen Monarchen von früher ähnlich, der alten Obrigkeit, den autokratischen Staatsführern. Sie halten die steile Hierarchie aufrecht, in der die Oberen beschliessen und die Unteren die Folgen zu tragen haben. Zugleich sind die Regierenden die Spitzenkräfte der politischen Unterhaltung.
Viele Bürgerinnen und Bürger wollen es auch so. Schliesslich haben sie keine wirkliche Wahl. Die Wege zu Lösungen sind blockiert. Viele andere machen bei rechtslastigen Bewegungen mit, wollen die Regierenden stürzen und eigene Leute an deren Stelle setzen, sodass alles noch schlimmer würde. Nein, Verzweiflung ist furchtbar. Was wir brauchen, ist Vernunft.
In Spanien hat das Volk zuletzt zweimal hintereinander das Parlament gewählt, ohne dass dieses dann eine Regierung gewählt hätte. Es kann sein, dass das Wahlvolk noch öfter vergeblich antreten soll. Stattdessen sollten seine Abgeordneten im Parlament selbst das Nötige tun, ihre gemeinsame Verantwortung annehmen und politische Entscheidungen treffen. Ein Vorbild ist die Schweiz, die zwar eine bescheidene Kollegialregierung mit jährlich wechselndem Vorsitz, aber kein Staatsoberhaupt hat.
Regierungen sind Segel, das Volk ist Wind, der Staat ist Schiff, die Zeit ist See.
(Ludwig Börne, 1786-1837)
Wir können miteinander darüber sprechen, was wir wollen, was wir uns für das Zusammenleben wünschen, wie wir unsere Gemeinschaften, die Gesellschaft, das Miteinander der Völker gut finden. Wir brauchen Volksabstimmungen über alle wichtigen Fragen. Für anstehende Probleme brauchen wir gute Lösungen. Räte von berufenen Fachleuten, die von Parteien und Lobbys unabhängig sind, sollen zusammen mit festen Fachkräften der öffentlichen Verwaltung in transparenten Verfahren Lösungen erarbeiten und vorschlagen. Die vom Volk gewählten Parlamente sollen über die laufenden staatlichen Geschäfte sachlich, nachvollziehbar, mit wechselnden Mehrheiten entscheiden. Für internationale Verhandlungen werden kompetente Persönlichkeiten aus dem Parlament, der Verwaltung, der Bevölkerung entsandt. Das bedeutet: Regierungen brauchen wir nicht mehr.
Wir alle bestimmen, was geschehen soll. An der Entwicklung von Gedanken und Vorstellungen zu praxistauglichen Programmen sollten wir nach unseren Möglichkeiten mitwirken. In solchen gemeinsamen, gerechten Entscheidungsprozessen werden nicht alle Wünsche erfüllt, aber wir werden Ergebnisse erhalten, mit denen wir zufriedener sein können. Wir regieren uns selbst am besten!
Salvatore Gentilesco
übersetzt von maximil
[Dazu:
Fortschritt?
Wird etwas besser?
Alle gestalten mit - so geht Demokratie]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
30. Juni 2016
Wenn ein Land seine Grenze deutlich machen will wie Großbritannien in der Volksabstimmung über die Zugehörigkeit zu Europa, lässt sich das verstehen. In diesem Fall liegt die Trennlinie nach wie vor im Wasser und verschwimmt – was sich ändern soll, ist noch nicht entschieden. Aber Grenzen haben immer zwei Seiten, und sie sind wichtig.
Andere Lebewesen kennen ihre Grenzen besser als Menschen. Die neigen dazu, persönlich, politisch, ökonomisch zu missachten, was sie als Hindernis oder Beschränkung empfinden, und richten damit Schaden an, bei sich selbst und der Mitwelt. Für Kinder ist es natürlich, von Grenzen erst einmal nichts zu wissen, und die Erwachsenen haben die Aufgabe, sie ihnen zu erklären. Manche der Älteren gehen in der Arbeit über Leistungsgrenzen und brauchen dann Therapie. Im Sozialen und Zwischenmenschlichen ist Grenzüberschreitung ein Fehlverhalten.
Grenzen sprengen ist gewalttätig und Grenzen verschieben oder erweitern kann, wenn es nicht einvernehmlich geschieht, Betrug sein. In der Geschichte haben Länder ihre Grenzen durch Eroberung, Besetzung und Kolonisierung erweitert, auf Kosten der Besiegten und mit dramatischen Konsequenzen bis heute. Für die Wirtschaft haben Fachleute schon lang „Grenzen des Wachstums“ aufgezeigt, und nachdem die roten Linien inzwischen überschritten sind, hat die Menschheit unter anderem unwiderruflich mit den Folgen des Klimawandels zu tun.
Ohne Grenzen gibt es keine Identität. Deshalb gelten sie selbstverständlich oder werden nach Bedürfnissen und Möglichkeiten definiert: Hier ist mein Eigenes oder das sind unsere Besonderheiten, und jenseits sind die Rechte der Anderen. Die europäische Kultur will die individuelle Persönlichkeit entwickeln, aber sie hat auch die expansive kapitalistische Wirtschaft erfunden, die weltweit das Besondere gleich macht und Lebensweisen vereinheitlicht. Das fordert dazu heraus, auf die eigenen Werte zu achten.
Die grossen Wirtschaftsunternehmen akzeptieren keine Grenzen. Dies zeigt sich in der Geschichte der Europäischen Union: Sie begann als „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“, und die Grenzen zwischen den Ländern wurden zuerst für das Kapital und den Warenverkehr aufgehoben und danach für die Menschen. Der Wettbewerb hat sich seither verschärft, regionale Unternehmen vernichtet und zu härteren Arbeitsbedingungen geführt. Konzerne und Regierungen vereinbaren darüber hinaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit internationale Freihandelsabkommen mit weitreichenden Auswirkungen auf das Leben.
Das Gute der Union war, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden zwischen den europäischen Völkern gebracht hat – allerdings haben ihre Mitglieder später verstärkt Kriege ausserhalb betrieben, und gerade die alte Kolonialmacht Großbritannien stand mit Militäraktionen gegen Argentinien oder im Irak wiederholt an vorderster Front. Angesichts der Flüchtlinge, die auch wegen solcher Konflikte kommen, macht Europa seine Aussengrenzen zur Abwehr von Menschen dicht. Mauern und Zäune, die ausgrenzen, sind asozial, und als Zeichen von Feindschaft lösen sie Probleme nicht.
Die politischen Bewegungen, die sich in Europa für selbstbestimmtes Leben einsetzen, riskieren, dass die Wirtschaft weniger wächst oder zurückgeht. Damit zeigen die Beteiligten, was ihnen vorrangig ist. Vielen ist das offenbar gar nicht bewusst. Sie bekämpfen die Anderen, speziell die Fremden, statt das Eigene und die Gemeinschaft zu gestalten. Gespräche und Diskussionen, privat und organisiert im öffentlichen Raum, in den Ländern und über Grenzen hinweg, sollten das zu klären helfen. Und dann muss möglich sein, dass alle demokratisch entscheiden, wie sie leben wollen, für sich und zusammen.
maximil
[Dazu:
Fällige Kritik des Wachstumsdenkens
Wirtschaft ist nicht alles]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik
28. Januar 2016
Als die ersten Filme mit Ton gedreht wurden, um das Jahr 1928, bekamen die bisher stummen Schauspieler und Darstellerinnen auf einmal eine Stimme. Das Publikum war oft überrascht. Viele im Kino hatten sich bei der früheren Pantomime derer, die sie kannten, andere Stimmen vorgestellt. Für manche der Schauspielenden wurde es schwierig, auch sprachlich zu überzeugen. Einige gewannen mit ihrer Stimme mehr Ausdruckskraft, Charme oder Faszination. Wenn die Filme allerdings seither in weiteren Sprachen gezeigt und dafür synchronisiert werden, können die Produktionsfirmen die vermeintlich passenden Stimmen wählen.
Bei der Aufnahme der alten, analogen Filme wurden die Stimmen, Geräusche und Musik ähnlich wie die Bilder fotografiert: Zunächst in elektrische Schwingungen umgewandelt, veränderten sie in der Tonkamera das Licht einer Lampe, das dann eine Zackenschrift auf den Filmstreifen zeichnete. Die Stimme wurde sichtbar. Das war das Lichtton-Verfahren.
Der Tonfilm konnte das Bild und die Stimme eines Menschen wieder zusammenfügen. Wie stumme Bilder schon seit Jahrtausenden Portraits von Persönlichkeiten über Entfernungen und Zeiten weitergeben, übertragen neuere Kommunikationsmittel umgekehrt unsichtbare, körperlose Stimmen: das Telefon, die Schallplatte, das Radio. Diese Stimmen regen noch mehr zu Vermutungen über die Personen an, die damit Zeichen geben, und öffnen weite Räume der Fantasie.

Roberto Benigni als Ivo Salvini in dem Film “La voce della Luna - Die Stimme des Mondes” von Federico Fellini, 1990: “Ihr habt es auch gehört - sie rufen mich, sie haben mich gerufen …”
Wer die eigene Stimme von einem Gerät aufzeichnen lässt und sie dann hört, empfindet sie erst als fremd. Der akustische Spiegel macht besonders deutlich, dass wir uns anders wahrnehmen, als wir auf unsere Mitmenschen wirken. Aus dieser Erkenntnis kann folgen, sich selbst aufmerksam und kritisch zu betrachten, anschliessend bewusster zu handeln und zu sprechen, insgesamt mit Gespräch und Empathie das Selbstbild und das Bild, das den anderen geboten wird, übereinstimmender zu gestalten.
Die Art des Sprechens ist wichtig dafür, wie jemand verstanden wird, welcher Eindruck vom Charakter und wie viel spontane Sympathie entstehen, wie weit Ziele zu erreichen sind. Deshalb ist es ratsam, die Stimme zu üben. Sie kann angespannt klingen oder locker, rau oder weich, zu hoch oder zu tief, zu laut oder zu leise, gehetzt oder träge, hell oder dunkel, nuschelig oder deutlich, brüchig oder fest, schneidend oder einschmeichelnd, tonlos oder klangvoll, monoton oder melodisch. In der Stimme kommen Emotionen zum Ausdruck, bis hin zum Lachen und Weinen.
Mit genau artikulierten Lauten, gezielt betonten Worten, geeigneten Pausen und Rhythmen wird das Sprechen zur Rede, zum Argument und zur Mitteilung. Vorausgesetzt sind Gedanken, die in treffende Aussagen geformt sind, mit der richtigen Wortwahl, klaren Sätzen und Aufmerksamkeit für das zuhörende Gegenüber. Manche hören sich gern reden und merken nicht, dass sie nerven … Eine angenehme Stimme, achtsames Sprechen und soziales Reden werden am besten schon im Kindesalter entwickelt.
Der Atem trägt die Stimme. Er bringt dem Organismus die Luft zum Leben, das ihn mit Lauten, Gesang, Botschaften wieder aussendet. Für gutes Sprechen und Singen setzt die Stimmbildung beim Atmen an.
———————————————————————–
Der geschriebene Text liegt ruhig da. Manchmal flimmert er auf dem weissen Grund. Wie mit dem Finger in den Sand gezeichnet. Wind kommt auf … Atem. Behauche die Schrift, damit sie hält. Lies sie vor, solange sie da ist. Durch die Stimme wird daraus deine Geschichte. Du gibst sie wieder, vernehmlich, klangvoll. Schall und Rauch? Die gesprochenen Worte scheinen dahinzugehen und zu verschwinden. Diffuse Energie, Welle auf dem Ozean. Aber durch sie bist du gewachsen. Jemand hört zu und ist bewegt.
Claire Destinée
———————————————————————–
Klangreiche, intensive oder dramatische Texte, gleich ob mündlich oder schriftlich übermittelt, verführen dazu, sie selbst zu sprechen, im Fall von Liedern zu singen, sie sich zu eigen zu machen und dabei die eigene Stimme zu fördern. Das geht beim Weitererzählen von Geschichten so, beim Lautlesen sprachstarker Passagen, beim Vorlesen und Rezitieren. Im Nachsprechen und Wiederholen religiöser Worte, Formeln und Texte können Menschen ihr Empfinden der Welt und des Daseins verändern, vertiefen oder steigern.
Die Stimme der Götter ist immer wieder durch Propheten, Heilige und Prediger hörbar geworden. Dabei entsprang das, was verkündet wurde, oft einem beschränkten menschlichen Verstand, und geistliche Führer sprachen wie weltliche Herren in eigenem Interesse. Die fernübertragene Stimme, die technisch möglich geworden ist und eine breite Öffentlichkeit erreichen kann, hatte anfangs etwas Magisches, und Mächtige konnten durch sie wie Götter wirken. Moderne Diktatoren nutzten Rundfunk und Lautsprecher für totale Macht: Die deutschen Nationalsozialisten brauchten für ihre Reden bei Massenveranstaltungen auf weiten Plätzen und in grossen Hallen die Beschallungsanlagen, um bis in die hintersten Reihen zu dringen und noch die Letzten anzusprechen, und sie verwendeten die “Volksempfänger”, um mit ihrer Propaganda auch in den Wohnungen präsent zu sein, wo die ganze Familie zuhörte.
In der Demokratie, wie sie danach neu entstand, kommt das Volk zu Wort, die Bürgerinnen und Bürger haben die Meinungsfreiheit und das Stimmrecht. Aber ihre Wahlstimme ist wenig aussagekräftig. Beim Wahlakt nennt sie meistens nur einen Parteinamen, gelegentlich noch Namen von Personen. Davor und danach ist sie für Jahre stumm, ohne an politischen Entscheidungen mitwirken zu können.
———————————————————————–
Demokratische Resonanz bedeutet, dass die eigene Stimme im politischen Konzert zur Geltung gebracht werden kann, dass sie sich mit den anderen Stimmen vereinigt und dass sie auf einen Widerhall stößt, der oft genug auch ein scharfer Widerspruch sein kann, dass sie Folgen hat. Die Politikverdrossenheit, welche die Menschen auf die Straße oder auch zur AfD treibt, hat ihre Wurzel darin, dass die Bürger den Eindruck haben, ihre Stimme bleibe ungehört, sie finde keine Resonanz. (…) Die Stimme des Bürgers wird in der Wahlkabine „abgegeben“ und scheint dann verloren. Anders als in der etwa von Jürgen Habermas konzipierten Sphäre der Öffentlichkeit, in der sie sich als Stimme der Vernunft hörbar macht, oder in der politisierten Kultur der Nach-1968er-Jahre, als sie sich im Protestlied der Rebellierenden und in der Rockmusik wirkmächtig und fühlbar zu artikulieren verstand, wird die Stimme des Bürgers in der spätmodernen Welt vornehmlich in zwei Formen vernehmbar, die schon Entfremdung signalisieren: im Protestschrei der Wutbürger, der Widerhall sucht und dabei Repulsion, feindliche Ablehnung, zum Ausdruck bringt, und im medial erzeugten und verbreiteten (zynischen) Gelächter, das die diesseits und jenseits des Atlantiks so ungemein erfolgreichen politischen Comedy-Shows wie die „Heute-Show“ oder „Die Anstalt“ erzeugen und verbreiten. Der spätmoderne Bürger lacht aus Verzweiflung über eine Politik, die ihr nicht mehr antwortet, die ihr nichts zu sagen hat. (…) Das schließt indessen nicht aus, dass der in allen genannten Bewegungen hörbare Schrei nach Antwort den Beginn eines neuen politischen Zeitalters markieren könnte, das sich aufmacht, in der spätmodernen Welt angemessene Resonanzinstitutionen zu suchen und zu finden.
Hartmut Rosa, “Fremd im eigenen Land?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 24.4.2015
———————————————————————–
Dass Meinungen in verschiedener Form geäussert werden, ist zwar bedeutsam für die Diskussion und die Suche nach Lösungen, jedoch nehmen die Regierenden davon derzeit nur das auf, was ihnen zusagt. Die Stimme der Menschen in den Angelegenheiten der Gesellschaft wird erst dann vollwertig, wenn es bei allen wichtigen Themen regelmässige Beteiligung und gültige Abstimmungen gibt.
Matthias Kunstmann / maximil
> Phonorama - Ausstellung zum Medium Stimme, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe 2004/2005
> Andra Joeckle, “O Stimmcoach, hilf! Ein vokaler Selbstversuch”, Deutschlandradio Kultur 21.11.2015
[Dazu:
Demokratie und was dran ist
Alle gewinnen mit Empathie]

Themen: Allgemein · Kultur · Natur · Politik